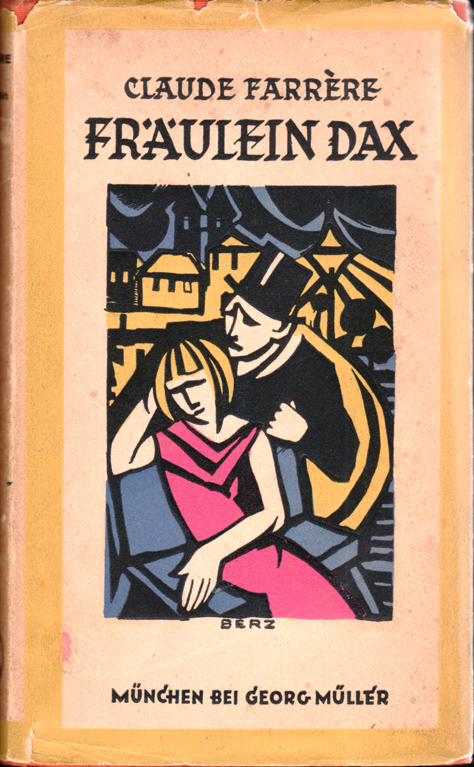eu-konkurrenz im Buhlen um die Gunst der USA
Die europäische Konkurrenz im
Buhlen um die Gunst der USA
Die USA setzen die Vorgaben und die europäischen Mächte fahren darauf ab. Freiwillig, doch mit jeweils eigenen Berechnungen. Diese sind ihren eigenen staatlichen Ansprüchen geschuldet und fallen daher nicht gerade unbescheiden aus. Eine Geschlossenheit der EU-Staaten erweist sich dabei dabei als wenig hilfreich. Jede Demonstration eben solcher Geschlossenheit läßt die Heuchelei unschwer erkennen.
Am trefflichsten wird das ersichtlich im Falle des von der BRD angetriebenen Projekts der Eingemeindung der Ukraine ins EU-Europa. Der damit verbundene Affront gegen Rußland, zu dessen historisch-kulturellen Einflußgebeit jener Staat unzweifelhaft zählt, war ein Unternehmen, sich bei den USA, auf deren Unterstützung Deutschland ja vor allem in Sachen Gewalt angewiesen ist, beliebt zu machen.
Das EU-Assoziierungsabkommen mit der Ukraine war 2014 unter Dach und Fach. Der dafür nötige Putsch in Kiew entfachte einen Bürgerkrieg in der früheren Sowjetrepublik ganz im Osten, im Donezk-Gebiet. Und als alle Schlichtungsbemühungen (Minsk I, Minsk II sowie die Istanbul-Verhandlungen, westicherseits sah man sie als Test auf die Nachgiebigkeit Moskaus) letztlich zerschlagen waren — der Westen hatte sie nie ernsthaft betrieben —, kam es zu dem, was Rußland — um die Bereitschaft zur Deeskalation weiterhin zu zeigen (die freilich im Westen ganz dogmatisch nicht gewürdigt wird) — die »Spezielle Militärische Operation (SMO)« nennt.
Damit war klar, daß die BRD auf die militärische Unterstützung der USA für eben diesen Stellvertreterkrieg angewiesen war, den sie eben dann zusammen mit den USA sowie den übrigen NATO-Staaten von ihrer »Kiewer Demokratie« führen ließen. Das freilich machten die USA nicht so ohne weiteres mit: Schließlich obliegt ihnen in diesem Falle die Federführung. So waren sie es sich schuldig, den Hauptanstifter Deutschland einem Test diesbezüglich zu unterziehen, wie ernst er es denn meine mit dem Krieg gegen Rußland.
Der Test — und da zeigte sich einmal mehr, daß die USA nie zimperlich in ihrem Vorgehen sind — bestand in der Sprengung der Nord Stream Pipelines (2022), zielte also auf fundamentale Abhängigkeit der BRD vom russischen Erdgas. Der deutsche Staat hat den Test in Person seines Bundeskanzlers Scholz glänzend bestanden. Der eilte nämlich schnurstracks nach Washington und demonstrierte herzlichstes Einvernehmen mit dem amtierenden Präsidenten Biden, als wäre nichts gewesen. Mit Fug und Recht kann man in diesem Falle von einer Win-Win-Begegnung sprechen. Im übrigen hegt Präsidentschaftsanwärter Trump nach wie vor Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Bündnispartner, wenn er auf ihren — seiner Meinung nach— zu geringen Beitrag zur Kriegsfinanzierung verweist.
 Im EU-Rahmen war die BRD nun erst recht obenauf. Sie bestimmte die offensive Stoßrichtung. Das stieß insbesondere in Frankreich auf einigen Widerwillen. Auf der einen Seite konnte und wollte man dort ja nicht aus dem EU-Erweiterungsprojekt auf Kosten Rußlands aussteigen. Auf der anderen Seite war damit das Selbstbewußtsein der Grande Nation angekratzt. Schließlich hat sich der französische Staat seit dem Zweiten Weltkrieg viel auf seine privilegierten Beziehungen zu den USA zugutegehalten, waren es doch hauptsächlich US-Truppen, die die Boches aus Frankreich wieder vertrieben. Gerade so gesehen waren und sind die USA für Frankreich ein Rückenschild gegen Deutschland, dem man bei aller geheuchelten Freundschaft mißtraut. Und wie sich am aktuellen Fall zeigt zurecht: Sollten Deutschlands Beziehungen zu den USA tatsächlich besser sein als die Frankreichs? Klar, daß dann nach Scholz auch Präsident Macron in Washington aufkreuzen mußte. Selbstredend wurde einmal mehr die Einigkeit des Westens beschworen, wofür die jeweiligen Interessensgegensätze ja den Grund abgeben.
Im EU-Rahmen war die BRD nun erst recht obenauf. Sie bestimmte die offensive Stoßrichtung. Das stieß insbesondere in Frankreich auf einigen Widerwillen. Auf der einen Seite konnte und wollte man dort ja nicht aus dem EU-Erweiterungsprojekt auf Kosten Rußlands aussteigen. Auf der anderen Seite war damit das Selbstbewußtsein der Grande Nation angekratzt. Schließlich hat sich der französische Staat seit dem Zweiten Weltkrieg viel auf seine privilegierten Beziehungen zu den USA zugutegehalten, waren es doch hauptsächlich US-Truppen, die die Boches aus Frankreich wieder vertrieben. Gerade so gesehen waren und sind die USA für Frankreich ein Rückenschild gegen Deutschland, dem man bei aller geheuchelten Freundschaft mißtraut. Und wie sich am aktuellen Fall zeigt zurecht: Sollten Deutschlands Beziehungen zu den USA tatsächlich besser sein als die Frankreichs? Klar, daß dann nach Scholz auch Präsident Macron in Washington aufkreuzen mußte. Selbstredend wurde einmal mehr die Einigkeit des Westens beschworen, wofür die jeweiligen Interessensgegensätze ja den Grund abgeben.
Diese Gegensätze sind mit den Einigkeitsbeschwörungen natürlich nicht aus der Welt. Frankreich hat nach dem siegreichen Ersten Weltkrieg maßgebend die Staatenkarte Europas gestaltet. Nun hat die Verlierermacht beider Weltkriege sie umgestaltet, zunächst durch die Zerschlagung Jugoslawiens, wobei Frankreich nicht über eine Zuschauerrolle hinauskam. Und nun die Sache mit der Ukraine, einer Sache, welche die beanspruchte besondere Stellung in Washington zu untergraben droht. Das zu verhindern, ist sich die französische Nation selbstredend schuldig. Da das Aussteigen aus dem Ukraine-Projekt schon allein damit ausgeschlossen ist, versucht man in Paris eigene Akzente in dem Krieg zu setzen. Militärische Akzente mit besonders beeindruckenden Waffenlieferungen, mit Militärberatern vor Ort, womöglich sogar eigenen Hilfstruppen.
Sollte der nächste US-Präsident, der ja aller Wahrscheinlichkeit Trump heißt, den Ukraine-Konflikt tatsächlich beenden, dann käme das Frankreich gar nicht so ungelegen. So sieht man es realistischerweise jedenfalls in Beijing — Chinas Präsident Xi Jinping war nicht zufällig kürzlich in Paris, neben Serbien und Ungarn — Ungarns Präsident Orban bemüht sich im Gegensatz zu den übrigen EU-Staaten um eine Beendigung des Krieges — der einzigen Station auf seiner Europareise. Allerdings liegt es, wie gesagt, nicht in Macrons Händen, den Vorreiter einer Konfliktlösung zu machen, da er ja einen offenen Riß mit den USA vermeiden möchte. Außerdem will er den Streit um die Vormacht in der EU nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, was ja einer Schädigung französischer Weltmachtinteressen gleichkäme.
Auch Italien, die dritte Macht in der EU will sich in der Ukraine-Affäre nicht lumpen lassen und bleibt bei Stange. Und das, obwohl Gerüchte der Ministerpräsidentin Meloni, die aus dem faschistischen Lager kommt, gute Beziehungen zu Moskau nachgesagt haben. Wie dem auch sei, jedenfalls will Italien seine außenpolitische Stellung nicht durch einen Affront gegen die USA, Deutschland und Frankreich schwächen. Davon zeugen zum einen die weiter durchgeführten Waffenlieferungen an die Kiewer von Faschisten maßgeblich gelenkte Regierung, vor allem aber auch der Rückzug aus der von der Vorgängerregierung beschlossenen Teilnahme an der Belt & Road Initiative Chinas. Letzteres ist insofern bemerkenswert, als die USA einen ausgesprochen antichinesischen Kurs eingeschlagen haben. (Auch Faschisten verstehen sich auf staatspolitischen Opportunismus!)
So tief die Gräben der ambitionierten NATO-Mächte sind, so lächerlich ist die Rolle ihrer Vasallenregimes. Diese könnten höchstens zur Kenntnis nehmen, wer die Kosten imperialistischer Bestrebungen zu tragen hat. Ein Aussteigen aus ihrer Rolle ist nichtsdestotrotz nicht erlaubt: Daher ist der ukrainische Präsident permanent auf Bittstellertour. Er spielt diese Rolle großartig.
18.07.24
feedback: info@koka-augsburg.com
literatur farrère
Ankommen und Abholen
Politiker, Politisierte und der Funktionszusammenhang
Vom Ankommen und Abholen
Der Politiker
Der Staat und seine Räson wird in der Politik repräsentiert. Die Träger der Repräsentation sind Personen, die eben die Politik machen, welche dem Staat zu dienen ent- und verspricht. Notwendigerweise eine von ihrer Person und den anderen Angehörigen des Staates abstrahierte Angelegenheit. Politiker laufen deshalb zweigeteilt durch die Welt: Auf der einen Seite sind sie Individuen, auf der anderen Seite eben davon abstrahierte Staatsfunktionäre. Dies zu vermischen ist daher ein großer Fehler, fällt gegebenenfalls juristisch unter den Begriff Korruption und wird, wenn aufgedeckt, entsprechend bestraft.
Wie schwer es Politiker haben, immerzu so gut wie ausschließlich für den Staat da zu sein! Diese Mühsal lassen sie sich daher entsprechend vergüten. Ein Anreiz, sich in die Staatsbelange ganz tief hineinzudenken, ist das gerade dann, wenn man als ein Parteimitglied auf der politischen Karriereleiter nach oben zu klettern strebt. Wenn eine Führungskraft aus der Wirtschaft, ein Kapitaleigner zumal sich herabläßt, in die hohe Politik einzusteigen, dann verdankt sich das einem schier ununterdrückbaren Drang nach Anerkennung in der und durch die Öffentlichkeit. Andere Parteimitglieder verspüren diesen Drang nach Anerkennung nicht minder, wenn sie sich entschließen, Karriere in einer Partei und damit gleichzeitig als Staatsrepräsentant zu machen. Die Bedingung dafür, sich durchsetzen zu wollen, erfordert einige Anstrengung und Skrupellosigkeit. Durchsetzungsfähigkeit wird allerdings als Tugend von der Öffentlichkeit sehr geschätzt. Denn sie wird als Unterpfand der Stärke des Staates betrachtet, einer Stärke, die als allgemein verbindlicher Anspruch außer Frage steht.
Während sich Politiker in ihrer Partei — zweckmäßigkeitshalber wählen sie die am besten zukunfts- und erfolgsträchtig erscheinende — durchzusetzen versuchen, beginnt gleichzeitig der Kampf gegen die Köpfe der konkurrierenden Parteien um Staatsämter. So ist das jedenfalls in der Herrschaftsform namens Demokratie; in anderen Staatsformen reduziert sich die Karriere auf die Durchsetzung in einer einzigen Partei. Doch wie auch immer die Form der Herrschaft verfaßt ist, ein Politiker nimmt die Staatsräson, die Staatsbelange allenthalben überaus ernst, womit seine andere, rein menschlich-materielle Seite möglichst überhaupt nicht mehr wahrzunehmen ist.
Umso irrer erscheint der Versuch der Medien, gerade dem Privatleben von Politikern nachzuspüren und es an die Öffentlichkeit zu zerren, und zwar zwecks Beurteilung seiner Qualifikation als Staatsmann. Dieses Vorgehen und das so gefundene Urteil — häufig ein bestätigtes Vorurteil — ist dem jeweiligen politischen Standpunkt geschuldet und dem Vergleich der Parteien und Politiker untereinander. Dieser Vergleich ist folglich nie objektiv, er wird ja immer unter dem Objekt, unter der Gürtellinie — der staatsfunktionellen Seite des betreffenden Funktionsträgers — geführt. Natürlich wissen die Politiker darum und sie entziehen der Öffentlichkeit weitestgehend möglich ihre Privatsfäre, in der es ja oft genug so manches zu vertuschen gibt. Ganz anders hingegen treten sie in Wahlkämpfen auf, in denen sie sich als ganz normale Staatsangehörige geben, als Menschen wie du und ich, also Menschen, die mit Politik sich nicht so intensiv abgeben, wenn überhaupt. Diese berechnende Haltung ist, so natürlich sie erscheint, zutiefst verlogen: Sobald sie die Wählerstimmen eingesackt haben und wieder ans Politikmachen gehen, gehen ihnen die Belange ihres Stimmviehs genauso an der Hutschnur vorbei wie zuvor. Als lästig wahrgenommen existiert das Stimmvieh dann einzig und allein als Manövriermasse des Staates und Verwertungsmasse seiner Wirtschaft. Deshalb ist (unter vielem anderem) Arbeitslosigkeit ein staatliches Problem und keines desjenigen, dem dadurch Geld zum Lebensunterhalt fehlt. Die Arbeitslosigkeit hat also zwei Seiten, doch nur eine interessiert den Staat und seine Funktionäre. Wer es nicht wahrhaben will, sei auf das Gezerre um Hartz IV verwiesen, das schönfärberisch in Bürgergeld umbenannt wurde, wobei gleichzeitig die Anforderungen noch funktioneller gestaltet worden sind: Noch schneller werden mittels drakonischen Sanktionen brachliegende menschliche Ressourcen in den Arbeitsprozeß gepreßt, anders ausgedrückt: der Ausbeutung unterworfen. Nach diesem Muster fortschreitender Funktionalität verhält es sich bei sämtlichen schwer umsorgten, als Problem verhandelten Staatsbelangen, mit denen die Politik ihren Beherrschten stets noch mehr abverlangt, zumutet.
Der politisierte Staatsangehörige
Als politisch denkender Mensch hat freilich nicht nur der Politiker die so zwingenden Staatsaufgaben in seinen Schädel eingesogen. Auch der politisierte Staatsangehörige hat gelernt, politisch zu denken. Er versteht sein eigenes materielles Interesse, sein Bedürfnis nach einem angenehmen, sorgenfreien Leben in ein politisches zu verwandeln. Das ist deshalb einfacher zu erreichen, als es erscheint und zwar einfach dadurch, daß er in ein Abhängigkeitsverhältnis zum Staat und dessen Wirtschaftsordnung gestellt ist. Hans und Gretel brauchen also nur dieses Abhängigkeitsverhältnis von Grund auf mit einem Plus zu versehen. Das gelingt am besten durch einen Vergleich mit früheren Zeiten oder mit anderen Staaten, in denen die Lebensbedingungen schlechter waren beziehungsweise sind. Dieser Vergleich erklärt gleichzeitig den Grad des Nationalbewußtseins. In einem so mächtigen Staat wie den USA ist dies selbst unter den Ärmsten sehr mächtig, so mächtig, daß es geradezu als ein Zufluchtsort der bedrängten Kreatur bezeichnet werden kann. Wenn das Nationalbewußtsein einmal solches Ausmaß erlangt hat, hält der Staat selbst den Schein von sozialer Sorge für ziemlich überflüssig — selbst der Ärmste hat doch schon alles, was er aus Staatssicht einzig und allein benötigt, nämlich das richtige Bewußtsein, das, einem erfolgsgesegneten mächtigen Staat anzugehören.
Angehörige weniger mächtiger Staaten dürfen dann ausnahmsweise auch mal jauchzen, dann, wenn ein nationaler Erfolg erreicht wird. So wird für sie charakteristischerweise der Beitritt des Staates, dessen Angehörigkeit sie besitzen, zu einem Staatenblock als ein persönliches Erfolgserlebnis verbucht. Man denke an all die NATO-, EU- und Euro-Staaten, für die so viele gerade in Süd- und Osteuropa (doch nicht allein dort) sich begeistern, auch wenn sie für ihre Person schauen können, wie sie sich mit den vorherrschenden Lebensbedingungen herum- und Tag für Tag durchschlagen können. Ihre Gesundheit, die dabei allenthalben notwendigerweise ruiniert wird, schadet dabei ihrer national bewegten Laune nicht, ganz im Gegenteil. So denken sie auch nicht über ein staatlich eingerichtetes Gesundheitswesen nach, dem sie zwangsläufig früher oder später anheimfallen und das bekanntlich nicht so kostenlos ist wie das auf Kuba. Nationalflaggen allüberall selbst am Krankenbett, das gefällt der Politik: Sie weiß die Politisierung ihrer Untertanen, hofierend »Bürger« genannt, sehr zu schätzen!
Diese Abstraktionsleistung von ihren eigenen Bedürfnissen, die die Politik so zu schätzen weiß, ist dennoch nicht ganz so einfach zu haben, wie es zunächst scheint. Sie erfordert nämlich eine Verschiebung der Bedürfnisse auf die Bedürfnisse, die in einer so fortgeschrittenen Gesellschaft notwendig sind, um sich nicht bloß über Wasser zu halten. Als Gesellschaftsmitglied will der Mensch anerkannt sein. Dies ist unabtrennbare Voraussetzung seiner Politisierung. Er braucht dies und das. Er braucht nicht bloß Essen und Trinken, sondern besseres Essen und Trinken. Er braucht nicht nur ein Obdach, sondern eines, das sich sehen lassen kann. Er braucht ein eigenes, möglichst attraktives Fortbewegungsmittel, nicht bloß ein öffentliches, und nicht bloß, um an den Arbeitsplatz zu kommen. Er braucht nicht bloß ein Festnetztelefon, sondern möglichst das neueste smarteste Handy, das ihm das Profitinteresse der anderen Seite anrät. Er braucht nicht nur einen Urlaub im engeren europäischen Umkreis, sondern verlangt danach, die Welt zu bereisen. Usw. usf. Objektiv betrachtet, hält er das für eine ihm zustehende Ent-Schädigung, was er sich jedoch selber nicht eingesteht! Jedenfalls ist das heutzutage allenthalben Benötigte ganz im Sinne einer staatsstabilisierenden Denkweise geradezu geboten. Denn damit hält er, der Untertan der er ist, sich mittels seines Bewußtseins am Leben eines brauch- und verbrauchbares Rädchens und dient dem Staat, oft genug sogar dadurch, daß er seine Arbeitskraft verstärkt einsetzt, um all das zu erlangen, was ohne diesen zusätzlichen Verschleiß außerhalb des Bereichs seiner Möglichkeiten läge. Dem Staat wiederum ist es egal, ob der Staatsbürger Aufwand und Ertrag für sich richtig abzuschätzen weiß oder ob der sich darob Selbsttäuschungen hingibt. Sollte er seinen Selbsttäuschungen erliegen, fällt er ja doch wieder auf den Staat zurück, auf ein im Staats- wie Wirtsschaftsinteresse fungibles Gesundheitswesen zum Beispiel. Und da ist es dem Staat und seiner Politikerriege dann wiederum schnuppe, ob der Getäuschte den jeweiligen Behandlungsladen relativ gut findet oder auf ihn schimpft, wenn er sich eine bessere = teurere Therapie nicht leisten kann. Warum auch sollte Politiker es scheren, ob jemand Opfer seiner Illusionen geworden ist?
Gut, der Mensch als Staatsangehöriger ist ja längst da angekommen, wo er nach Meinung der Staatsverantwortlichen hingehört. Und genau dort holen sie ihn auch regelmäßig ab: Im alltäglichen Existieren unter den eingerichteten Zuständen. Dazu muß nicht einmal eine gute Miene gemacht werden, wenngleich »Optimismus« gewünscht und propagiert wird. Für die gute Laune sorgt überdies ein riesiges Unterhaltungsangebot. Das schließt außer zu den wohlgesehenen Geschäftszwecken den Nutzen ein, daß die verehrten Bürger auch in der arbeitsfreien Zeit nicht zum Nachdenken, nicht auf dem »Gemeinwohl« abträgliche Gedanken kommen [Kennzeichnenderweise ist »Shopping« nicht nur das systemgerechteste Angebot, es ist statistsch auch das längst am zweithäufigsten genannte Hobby (mit über 25% laut Allensbach)] und sich mit einer nüchternen Bestandsaufnahme ihrer eigenen Lage befassen, und zwar hinsichtlich der Staatsordnung, mit deren Zumutungen sie sich in mehrfacher Hinsicht herumschlagen müssen.
Auf solch unerwünschte Idee müßte man selber kommen, denn der Staat bietet dafür selbstverständlich keinerlei Handreichung. Im Gegenteil, er bestätigt sein menschliches Inventar in jeder Täuschung, der es sich hingibt. Die fundamentalste aller Täuschungen ist die, zu glauben, der Staat wäre für einen selber da (oder hätte grundsätzlich diese Aufgabe). Der Staat will die Getäuschten ja gerade da abholen, wo er sie hingestellt hat. Vorhersehbarerweise werden sie ja da dann auch abgeholt und zwar so, daß sie darüber erfreut sein können: Wenn Politiker Bürgernähe demonstrieren: Halleluja! Das ist ja fast wie in der Kirche, wohin der allmächtige Heiland die braven unschuldigen Kinderlein einlädt.
Funktionieren als Zweck
Wie man sieht, erzieht der Staat seine Bürger zu Ignoranten ihrer objektiv vorhandenen Lage. Funktionieren das heißt, die Staatsmaschinerie in all ihren Abteilungen am Laufen zu halten, möglichst reibungslos versteht sich. »Funktionieren« unterstellt schon all die Inhalte, die Staatsziele und Staatsaufgaben, die funktionieren müssen. Die stehen außer jedweder Diskussion »Funktionieren« müssen sie und »funktionieren« müssen daher alle; alle müssen deshalb an einem Strang ziehen; die Volkseinheit wird mit dem nationalen »Wir« eins ums andere Mal beschworen und vor »Spaltern« eindringlich gewarnt. Das alles hat sich auch jeder Kritiker zu Herzen genommen, wenn er kundtut, daß dies oder jenes gar nicht oder nicht richtig gut funktioniert: Er gibt kund, wie es funktioniert oder besser funktionieren könnte. Das versteht man von Staatsseite aus betrachtet als erfolgreiche Erziehung zur »Kritikfähigkeit«. In seiner Dogmatik wird damit der Staat samt seiner Räson wunderbar bekräftigt, er enthebt sich jeder auch nur denkbaren Kritik!
Ignoranz gegenüber dem Staat als solchem soll jedenfalls nicht als solche verstanden werden. So ist es im übrigen auch keineswegs dysfunktional, wenn getrickst wird und beispielsweise Doktorarbeiten abgekupfert werden. Schließlich ist noch keinem Fälscher vorgeworfen worden, er hätte sich daran verbrochen, funktionstüchtig und kritikfähig zu sein. Tricks unterstreichen ja gerade den Willen eben dazu! Ein Typ wie der im »Faust«, der behauptet, alles Mögliche studiert zu haben und so klug wie zuvor geblieben zu sein, schützt Erkenntnisinteresse vor, insofern er erfühlt hat, daß das ja gar nicht gefragt ist — es kommt vielmehr darauf an, sich aufzublasen, worin Herr Goethe selber ja ein Meister war (weshalb er über alle Staatsformen hinweg bis heute hoch verehrt wird). In Fachbereichen wie Jura und Theologie geht es mit Sicherheit nicht um Erkenntnisse, in den anderen Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften nicht minder. Welch uferloses Zeug da gelehrt und gelernt wird, Touristik beispielsweise! Dort kann man dann vielleicht etwas über das Klima in Bangla Desh erfahren, ein bislang touristisch nicht erschlossenes, aber möglicherweise umso geschäftsträchtigeres Reiseziel! Es gibt kaum einen Studenten, der mit einem anderen Gedanken die Hochschule betritt als den, sich als funktionsfähiges Tool irgendwo und irgendwie im Getriebe des Staates und seiner profitorientierten Wirtschaft zu etablieren. Und mit Erreichen dieses Ziels nach der Anerkennung heischt, die ihm sowohl der Staat wie die analog tickenden Mitbürger allüberall versprechen.
Schon Spinoza hatte erkannt, daß die von Staats wegen eingerichteten Universitäten zur Beschränkung und nicht zu Erweiterung des Denkens gegründet sind (Abhandlung des Staates, § 49). Wen sollte es da verwundern, wenn gerade an den Führungspositionen von Staat und Gesellschaft lauter »Experten« — autorisierte Fachleute, Leute mit entsprechenden Zeugnissen — zugange sind? Daß die Kompetenz eines solchen angezweifelt wird (von Konkurrenten einerseits, von politisierten Außenstehenden andrerseits), ist das Blödeste, was einem, der sich selber als Profi versteht, widerfahren kann. Ein Beispiel: Ein Verteidigungsminister muß sich auf Gewalt verstehen, muß Frieden sagen können, wenn er Erpressung und Krieg meint, muß Aufrüsten, wenn er als Friedenspolitiker verstanden werden will. Ansonsten kann er seinen Hut nehmen (gilt gleichermaßen für das gleichberechtigte weibliche Geschlecht); Beispiele kennt jeder Zeitungsleser.
Wenn jemand daran denkt, sein privates Leben komplett zu verpfuschen — was, wenn bei einem Einstieg in die Politik oder in die Bundeswehr, schon als ziemlich gelungen angesehen werden kann —, dann gebührten ihm Orden und bei seinem Ableben erhält er nach Rang auch ein Staatsbegräbnis. Höhere Staatsfunktionäre kriegen außerdem Skulpturen oder zumindest Straßennamen verpaßt; Soldaten zum Pack gebündelt Veteranentage und Kriegerdenkmäler. Denn in all solchen Fällen ist die Gleichsetzung von Person und Funktion sichtbar optimiert. Damit soll nicht ein mit funktionell eingesetzter Intelligenz vergeudetes Leben kundgetan werden, vielmehr ein solches als etwas anderes, als ein gesellschaftsnützliches für alle Ewigkeit gewürdigt sein. (Im übrigen ist der Gedanke, eine solchartige Intelligenz mit einer künstlichen zu ersetzen geradezu auf der Hand liegend.)
Fazit:
Wer den Staat und seine Bürger nun nicht endgültig voll geil findet, dem ist wahrlich nicht mehr zu helfen. Also schwenkt eure schwarz-rot-goldenen Fähnchen, sauft euch die Hucke voll (heißer Tip: Kann man bei der BW lernen!) und bleibt so funktionell, wie ihr selber es sein wollt und wie euer vielgeliebter Staat euch zu schätzen, weil in die Pflicht zu nehmen weiß. Denn euer Denken macht zwar nicht den Erfolg des Staates aus, wohl aber stellt es diesen Erfolg unter Beweis!
21.06.2024
feedback: info@koka-augsburg.com
us-imperialismus-israel
Muster & Methode des US-Imperialismus
und sein Spezialfall Israel
Nun ist es kein Geheimnis, daß die USA andere Staaten und deren Menschenmaterial für ihre Interessen, für ihre Weltdominanz einspannen. Da mag sich wer auch immer wunder welch eigene Interessen ausmalen, er sieht sich mit den Interessen der USA konfrontiert. So setzen nicht wenige darauf, mit den USA, mit deren Hilfe ihre eigenen Interessen voranzubringen, gerade in der »Dritten Welt« ein nicht selten vorgefundener Standpunkt. Ein Standpunkt, der sich oft genug überhaupt nicht leicht ent-täuschen läßt. Man denke nur an die Kurden in Syrien und im Irak, die seit Jahren für einen eigenen Staat kämpfen.
 Ein vergleichsweise neuer Fall sind die muslimischen Rohingya in Myanmar, als deren Protegé nun die USA auftreten*, weil ihnen die Militärregierung in Rangun nicht paßt. Eine Karikatur von Luo Jie aus 2014 zeigt den Fall im Nachbarland Thailand. Und eine ganze Reihe weiterer Staaten, deren Regierungen auf die USA setzen, als hätten sie — ihr Regierungspersonal ausgenommen — je von ihnen profitiert. Wie diese Staaten und insbesondere ihre Staatsbürger dabei auf ihre Kosten kommen, sieht man nicht immer so drastisch wie im Augenblick in der Ukraine und vormals in Vietnam, es sei denn man kommt einmal mehr auf den Hunger in der Welt zu sprechen. Die USA sind die letzten, die ihn bekämpfen. Weizensäcke liefern sie nur gelegentlich und das ausschließlich nach ihrem politischen Interesse: Die USA nutzen in solchem Falle gnadenlos die Not, die sie mit ihrer an Kapitalverwertung orientierten Weltordnung selber geschaffen haben, aus, um sich als Retter aufzuspielen. Und das unter den unumstößlichen Dogmata von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten. Was die USA allerdings nie daran gehindert hat, Diktaturen zum Bündnispartner zu haben. Menschen- und Völkerrechte (inklusive internationaler Gerichtshöfe) und Wahlergebnisse zählen für sie ohnehin nur, wenn es ihnen in den Kram paßt — eine verlogene Rechtfertigung finden sie dabei allenthalben. Rassistisch wie sie sind, gelten konsequenterweise nur ihre engeren Verbündeten** als zivilisiert. Nichtsdestotrotz werden auch sie mit allen Raffinessen moderner Technik überwacht. Fliegen Cyberangriffe auf, werden sie flugs Rußland und China in die Schuhe geschoben. Dabei wissen alle Computerfreaks, wie schwer oft solche Angriffe auf ihren Ursprungsort zurückzuverfolgen sind.***
Ein vergleichsweise neuer Fall sind die muslimischen Rohingya in Myanmar, als deren Protegé nun die USA auftreten*, weil ihnen die Militärregierung in Rangun nicht paßt. Eine Karikatur von Luo Jie aus 2014 zeigt den Fall im Nachbarland Thailand. Und eine ganze Reihe weiterer Staaten, deren Regierungen auf die USA setzen, als hätten sie — ihr Regierungspersonal ausgenommen — je von ihnen profitiert. Wie diese Staaten und insbesondere ihre Staatsbürger dabei auf ihre Kosten kommen, sieht man nicht immer so drastisch wie im Augenblick in der Ukraine und vormals in Vietnam, es sei denn man kommt einmal mehr auf den Hunger in der Welt zu sprechen. Die USA sind die letzten, die ihn bekämpfen. Weizensäcke liefern sie nur gelegentlich und das ausschließlich nach ihrem politischen Interesse: Die USA nutzen in solchem Falle gnadenlos die Not, die sie mit ihrer an Kapitalverwertung orientierten Weltordnung selber geschaffen haben, aus, um sich als Retter aufzuspielen. Und das unter den unumstößlichen Dogmata von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten. Was die USA allerdings nie daran gehindert hat, Diktaturen zum Bündnispartner zu haben. Menschen- und Völkerrechte (inklusive internationaler Gerichtshöfe) und Wahlergebnisse zählen für sie ohnehin nur, wenn es ihnen in den Kram paßt — eine verlogene Rechtfertigung finden sie dabei allenthalben. Rassistisch wie sie sind, gelten konsequenterweise nur ihre engeren Verbündeten** als zivilisiert. Nichtsdestotrotz werden auch sie mit allen Raffinessen moderner Technik überwacht. Fliegen Cyberangriffe auf, werden sie flugs Rußland und China in die Schuhe geschoben. Dabei wissen alle Computerfreaks, wie schwer oft solche Angriffe auf ihren Ursprungsort zurückzuverfolgen sind.***
Der Zionistenstaat Israel hat seine Abhängigkeit von den USA begriffen, eben auch und gerade die negative Seite, die nämlich, nach der er als Stützpunkt, als unsinkbarer Flugzeugträger und jederzeit verheizbares Material gegen jeden arabischen und muslimischen Feind der US-Vorherrschaft im Nahen und Mittleren Osten zu dienen hat und benutzt werden kann. Dementsprechend baut Israel seit jeher nicht allein auf die HIlfe der USA. Es meldet eigene Ansprüche an — gegen die USA. Sein Vorwurf lautet, daß die USA Israel nie richtig verstehen und sich deshalb nie richtig, also in ihrem Sinne für sie sich stark machen und einsetzen: Sie, die USA, sollen immerzu beweisen, daß sie Israel verstehen und seine Wünsche erfüllen. Die USA ihrerseits tun das Nötige, so daß Israel daran ebenso fortwährend glauben wie (ver)zweifeln kann.
 Als Donald Trump Präsident war, zerriß er 2018 das zuvor von der Obama-Regierung ausgehandelten Atomabkommen mit dem Iran und setzte die Sanktionen gegen ihn wieder ein. Das war ganz im Sinne Israels, freilich den Zionisten nicht genug. Die Ermordung des iranischen Generals Qasem Soleimani im Jahre 2020 war ein weiteres Entgegenkommen gegenüber Israel, freilich blieb auch dies darauf kalkuliert, es nicht zum Krieg mit dem Iran kommen zu lassen. Doch ein faschistischer Staat sieht sich selber immer im Krieg, den er ja auch permanent gegen die ihn störenden Palästinenser und weit darüber hinaus führt. Seine regelmäßigen Luftschläge gegen Ziele in Syrien passen den USA sehr wohl ins Konzept, da in Damaskus eine ihnen nicht willfährige Regierung die Macht innehat. Über den Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus wurden die USA im voraus nicht informiert. Nichtsdestotrotz erhoben sie im nachhinein keinerlei Einwände, wiewohl auch dieser Angriff ihrem Interesse nicht widersprach. (Wer beweist mehr Weitsicht: Die USA oder der Karikaturist Pang Li in der China Daily im Jahre 2012?)
Als Donald Trump Präsident war, zerriß er 2018 das zuvor von der Obama-Regierung ausgehandelten Atomabkommen mit dem Iran und setzte die Sanktionen gegen ihn wieder ein. Das war ganz im Sinne Israels, freilich den Zionisten nicht genug. Die Ermordung des iranischen Generals Qasem Soleimani im Jahre 2020 war ein weiteres Entgegenkommen gegenüber Israel, freilich blieb auch dies darauf kalkuliert, es nicht zum Krieg mit dem Iran kommen zu lassen. Doch ein faschistischer Staat sieht sich selber immer im Krieg, den er ja auch permanent gegen die ihn störenden Palästinenser und weit darüber hinaus führt. Seine regelmäßigen Luftschläge gegen Ziele in Syrien passen den USA sehr wohl ins Konzept, da in Damaskus eine ihnen nicht willfährige Regierung die Macht innehat. Über den Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus wurden die USA im voraus nicht informiert. Nichtsdestotrotz erhoben sie im nachhinein keinerlei Einwände, wiewohl auch dieser Angriff ihrem Interesse nicht widersprach. (Wer beweist mehr Weitsicht: Die USA oder der Karikaturist Pang Li in der China Daily im Jahre 2012?)
Sein jüngster Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser und ihren politischen Arm, die Hamas — übrigens per demokratischer Wahl vorbildlich legitimiert! —, im Gaza-Streifen ist ein neuerlicher Affront gegen die USA: Auf welcher Seite stehen diese und wie beweisen sie das? Die USA lassen sich nicht lumpen und schicken umgehend jede Menge Waffen in das ohnehin vor Waffen strotzende Israel. Dann schicken sie ihre Kriegsschiffe aus, um Mittelmeer und Rotes Meer zu kontrollieren. Sie lassen gleichzeitig eine internationale Propagandalawine zugunsten Israels anrollen, wie gewohnt unter Zurhilfenahme des einmal mehr mißbrauchten Begriffs »Antisemitismus«. Doch all das reicht Israel nicht. Anders als nach den Anschlägen in den USA im September 2001 sieht es nicht seinen Hauptfeind in al Qaida**** und im Irak — gegen den dann ein auf Lügen basierter Krieg begonnen wurde (der so leichenträchtig wie er war, als Genozid bezeichnet werden kann!) —, vielmehr im Iran und seinen Verbündeten im Libanon und im Jemen, worauf sie mit dem tödlichen Luftangriff auf die iranische Botschaft in Damaskus (April 2024) aufmerksam machen, welchen die USA nicht verurteilten, worauf Israel ja zählte. Und nach dem Muster der Ermordung von Osama bin Laden und Mitbewohnern (noch unter Präsident Obama, 2011) und des iranischen Generals Qasem Soleimani und seinen Begleitern (2020) — der übrigens auf dem Weg zur einer Friedenskonferenz in Bagdad unter Teilnahme Saudi-Arabiens war (was den USA natürlich überhaupt nicht paßte!) —, kommt seltsamerweise der iranische Präsident Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben (Mai 2024)*****. Die Ursache des Absturzes liegt bis heute im dunkeln. Man kann sich freilich gut vorstellen, welche Kreise in Israel — ähnlich den Mossad-Leuten 2001 in NYC**** — gejubelt haben.
Man kann sich natürlich fragen, wie lange die Supermacht sich noch von den Zionisten auf der Nase herumtanzen lassen will. Dabei darf man jedoch nicht übersehen, daß Israel sich eine Einflußzone in den USA selber geschaffen hat******. Einen Einfluß, der über sehr viel Geld und damit auch immer über die nötigen Staats- und Mittelsmänner in den verschiedensten Anstalten verfügt. Die USA sehen sich gezwungen, mit Israel kalkulierter umzugehen als mit kaum einem anderen »Partner«. Nutzen und Verdruß, das zeigen sämtliche Aktionen und Reaktionen der USA, stehen auf der Waage. Ihre imperialen Interessen natürlich nicht, die setzen sie durch und gehen dabei über Leichen, so wie sie es sich schuldig sind.
________________
* Die Recherchen zu den Umtrieben der USA in Südostasien ist dem in Thailand lebenden Journalisten Brian Berletic zu verdanken (siehe seine Südostasienbeiträge in seinem Kanal The New Atlas auf youtube).
** Inwieweit ein auf eigenen Nutzen gesetzte Berechnung gegen die USA ins Spiel gebracht werden kann, daran kommen mittlerweile im Falle der BRD Zweifel auf. Kein Wunder, daß in einem solchen Falle eine Opposition entsteht, die an der Staatsräson rüttelt, deren Protagonisten ihrerseits unumstößlich an ihrem Weltbild und ihren Dogmata eisern festhalten. Dafür veranstalten sie sogar Demonstrationen unter dem Vorwand des Antifaschismus.
*** KoKa hat das mal versucht und hat festgestellt, daß der Angriff nie aus dem Staat kam, der als Urheber auftauchte. In aller Regel war der Ausgangspunkt in den USA und es erfolgte eine mehrmalige Umleitung nicht selten um den ganzen Erdball. Wofür unterhalten die USA auch ihre riesigen Geheimdienstapparate, in die sie Jahr für Jahr Milliarden Dollar stecken? Dazu kommt, daß private Firmen wie u.a. Microsoft und Apple dem Staatsapparat zuarbeiten.
**** siehe hierzu, den mit umfangreichen Beweismaterial versehenen Film von Ryan Dawson »The Empire Unmasked«. Das ambivalente Verhältnis zwischen den USA und Israel verdient die Aufmerksamkeit, die es nach vorherrschender Meinung gar nicht haben soll!
***** Diese musterhafte Reihung artikuliert zum Beispiel Max Blumenthal.
****** Siehe dazu ein Interview mit dem Rapper Lowkey auf dem youtube-Kanal von BreakThrough News.
09.06.2024
feedback: info@koka-augsburg.com
verlogen gegen Antisemitismus
Die Stadtväter Augsburgs beweisen die Dummheit der deutschen Staatsräson
Der verlogene Kampf gegen den Antisemitismus
 Ludwig von Fischer war von 1866 bis 1900 Erster Bürgermeister von Augsburg. Der Straßendurchbruch vom Moritzplatz zum Königsplatz erfolgte unter seiner Amtszeit. Deshalb heißt diese Straße bis heute Bürgermeister-Fischer-Straße.
Ludwig von Fischer war von 1866 bis 1900 Erster Bürgermeister von Augsburg. Der Straßendurchbruch vom Moritzplatz zum Königsplatz erfolgte unter seiner Amtszeit. Deshalb heißt diese Straße bis heute Bürgermeister-Fischer-Straße.
Jener Fischer war ein Ultranationalist und gehörte als solcher dem Alldeutschen Verband (ADV) an, zeitweise sogar als Vorstandsmitglied. Dieser Verband drängte auf einen erneuten Krieg gegen Frankreich um die imperialisitissche Vorherrschaft. Er war zutiefst judenfeindlich, also antisemitisch gesonnen.
Das wurde dem Herrn Bürgermeister bis heute nicht übel genommen. Sein Grabmal auf dem Katholischen Friedhof an der Hermanstraße läßt sich die Stadt Augsburg auch heute noch jahraus jahrein eine hübsche Blumenbepflanzung kosten.
Angesichts des Gebrauchs bzw. besser des Mißbrauchs des Antisemitismus zur Rechtfertigung des Genozids des Zionistenstaats Israel an den Palästinensern in Gaza plakatierte die Stadt Augsburg Kampfplakate gegen den Antisemitismus nun in der Innenstadt, unter anderem auch in der Straße des Antisemiten Ludwig von Fischer.
Jede/r kann sehen, daß es gar nicht um einen Kampf gegen den Antisemitismus geht, sondern um einen Kampf zur Rechtfertigung der Machenschaften des Staates Israel, der mit seinem Genozid in die Fußstapfen der NSDAP tritt. Zu jenen Vorläufern der NSDAP zählt selbst bürgerlichen Professoren zufolge der ADV.
 Ein weiterer glühender Nationalist, Anhänger des NSDAP und selbstredend antisemitisch gesonnen, war der Musikkomponist Werner Egk. Dem Musikkritiker Konrad Boehmer zufolge war er »eine der übelsten Figuren nationalsozialistischer Musikpolitik«. Nach ihm ist ein Weg und gar eine Schule im Augsburger Stadtteil Oberhausen benannt. Vor rund zwei Jahren entspann sich eine Diskussion darum, ob die Schule nicht umbenannt werden sollte. Alle Versuche wurden seitens der städtischen Obrigkeit niedergeschlagen, die Augsburger Tagespresse billigte das: Hauptsache es herrscht wieder Ruhe — Antifaschismus kann nicht gelitten werden!
Ein weiterer glühender Nationalist, Anhänger des NSDAP und selbstredend antisemitisch gesonnen, war der Musikkomponist Werner Egk. Dem Musikkritiker Konrad Boehmer zufolge war er »eine der übelsten Figuren nationalsozialistischer Musikpolitik«. Nach ihm ist ein Weg und gar eine Schule im Augsburger Stadtteil Oberhausen benannt. Vor rund zwei Jahren entspann sich eine Diskussion darum, ob die Schule nicht umbenannt werden sollte. Alle Versuche wurden seitens der städtischen Obrigkeit niedergeschlagen, die Augsburger Tagespresse billigte das: Hauptsache es herrscht wieder Ruhe — Antifaschismus kann nicht gelitten werden!
Egk stand mit den NSDAP-Funktionären auf Du und Du und widmete dem Reich seine Kompositionen. Er wurde nie als Kriegsverbrecher verurteilt. Im Gegenteil: Noch lange im Nachkriegsdeutschland wurde er auf Notenheften für Schulen in einer Reihe mit den klassischen Komponisten wie Beethoven, Händel etc. genannt und zwar als einziger noch lebender! Mehr über diese faschistische Ekelfigur, seine NS- wie seine nicht minder ruhmreiche Nachkriegszeit findet sich auf wikipedia ausführlich eingetragen.
Unschwer zu beurteilen, wie verlogen der deutsche Kampf gegen den Antisemitismus ist! Ein Kampf bis auf die unterste politische Ebene, der die Wichtigkeit dieser Lüge beweist!
07.06.2024
feedback: info@koka-augsburg.com
linke Desorientierung
Linke Desorientierung
Nun haben es nur wenige linke, das heißt antikapitalistische und antiimperialistische Zeitungen und Zeitschriften ins 21. Jahrhundert geschafft. Und unter denen, die es geschafft haben, ist kaum noch etwas übrig geblieben, was diesen Begriff verdient. Diese Tatsache enthüllt, daß es mit dem seinerzeitigen kritischen Verständnis der Welt auch nicht allzuweit her sein konnte: Wie sonst hätte die Adaption an die bestehenden Verhältnisse passieren können? Ja, nicht einmal eine notwendige Spaltung in den Redaktionen hat es gegeben, es wäre das ja nicht zu übersehen gewesen. Allein der ein oder andere mag klammheimlich abgesprungen sein, bemerkend nicht die Mittel zu haben, den fahrenden Zug des Opportunismus aufhalten zu können.
Nun ist allerdings nichts als ein knallhartes Kontra notwendiger denn je: In Zeiten laufender imperialistischer Kriege (speziell die gegen Rußland und gegen die Palästinenser) und in Vorbereitung begriffenen imperialistischen Kriege (speziell die gegen Nord-Korea sowie gegen China u.a. wegen seiner Insel Taiwan); in Zeiten der kriegs- wie kapitalnotwendigen Verarmungspolitik.
Man könnte ja darüber diskutieren, wie, mit welchen Mitteln, mit welchen Argumenten den herrschenden Zuständen entgegengetreten werden kann. Allein schon das erweist sich als schwierig, wenn zum Beispiel Leserbriefe wie dieser unter den Tisch der monatlich erscheinenden Zeitung analyse & kritik (ak; vormals Arbeiterkampf) fallen:
___
LESERBRIEF zu »Multipolare Weltunordnung«* (ak 701) [vom 28.03.2024]
Was ist die Absicht, einen solchen Aufsatz in der ak zu veröffentlichen, noch dazu an herausragender Stelle, auf der Titelseite? Will die ak jene eindeutig proimperialistische Stellungnahme ihrer Leserschaft als irgendwie links, als Arbeiterkampf nahelegen? Wenn dem so ist, zeigt das nicht nur eine Fehleinschätzung ihrer Leser, vielmehr stellt sich darüber hinaus die Frage, ob die Redaktion statt Klarheit Verwirrung stiften möchte?
Der Eindruck, daß viele Linke gar nicht (mehr) wissen, wo der Feind steht, ist ohnehin erschreckend. Dabei ist es doch auf der Hand liegend, daß die Aggression vom Westen ausgeht, der so frei ist, die Ukraine dem russischen Einfluß entziehen zu wollen, und somit Rußlands Interesse herausfordert, und zwar so, daß deren Staatsführung sich zu einer Reaktion gezwungen sieht, will Rußland nicht selber zu einem Erfüllungsgehilfen westlicher Interessen degradiert werden. Dieses käme ja einer Selbstaufgabe seiner Macht gleich. —
Anstatt sich in die zwischenstaatlichen Belange einzumischen und Partei zu ergreifen, wäre es da nicht angebracht, zu überlegen, wie eine Katastrofe verhindert werden kann, wie Krieg überhaupt verhindert werden kann? Dem fehlt nämlich der Bremsklotz mehr denn je, nachdem die soziale Frage von nationalen Antworten dahingerafft wurde (das BSW dokumentiert das ganz aktuell). Die Arbeiterklasse im Westen, potenziell in der Lage, den imperialistischen Ansprüchen der G7-Staaten entgegentreten zu können, könnte auch für eine Entlastung der Arbeiterklasse in Osteuropa sorgen. Woran es schechthin fehlt, ist ein Klassenbewußtsein. Auch in Rußland, wo gar ein faschistischer Hochstapler als Hoffnungsträger betrauert wird (ak 702) und die dahinsiechende Kommunistische Partei längst (beginnend schon mit Stalin) eine Bankrotterklärung bezüglich einer Erklärung gesellschaftlicher Verhältnisse abgegeben hat, was offenkundig jenen Kommunisten nicht einmal aufzufallen scheint.
Freilich, jener reaktionäre Beitrag in der ak bestätigt die herrschenden Zustände und redet einer unipolaren imperialistischen Weltordnung das Wort, in völliger Übereinstimmung mit den amtierenden Charaktermasken in Nordamerika und Westeuropa, gleichgültig dagegen, wieviel diese kapitalistische Ordnung der Arbeiterklasse als staatlicher Manöriermasse an Kosten aufbürdet.
Kurzum, jene antirussische Hetzschrift, ist nun wirklich nicht geeignet, »linke Diskurse wieder in die Breite zu bringen«, wie das ein Leserbrief (in ak 702) der ak als Absicht zugutehält
___
* Im übrigen ist der kritisierte Artikel bei weitem nicht der einzige, der kritikwürdig ist.
Feedback: info@koka-augsburg.com
deutscher Imperialismus am Beispiel Marokko
Der deutsche Imperialismus am Beispiel Marokko
unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Sozialdemokratie auf ihrem Weg zu seiner Speerspitze
Im Januar diesen Jahres besuchte Entwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD Marokko. In der längst eingerissenen Art, mit als minderwertig eingestuften Staaten umzugehen, verlangte Sie, Marokko möchte Fachkräfte nach Deutschland kommen lassen. Im Gegenzug solle es bereit sein, die für nichtsnutzig erachteten, Hunger leidenden Flüchtlinge zurückzunehmen. Menschenrechtliche Vorhaltungen waren bei dieser befreundeten Diktatur selbstverständlich nicht angebracht. Der Rassismus der Bundesministerin steht übrigens in der schönen Tradition eines früheren SPD-Parteiführers namens Bebel, doch dazu, zu dessen Rede weiter unten.
Wer sich erinnert: Im Rahmen des ›Arabischen Frühlings‹ im Jahre 2011 – exakt 100 Jahre nach der 2. Marokkokrise, auf hier gleich eingegangen werden soll – gab es auch in Marokko einen Aufstand gegen das Regime, der freilich weder vom ›Freien Westen‹ inszeniert noch unterstützt wurde und daher auch rasch niedergeschlagen werden konnte, sehr zum Wohlgefallen unter anderem auch der mit dem Regime solidarischen deutschen Regierung und ihrer kongenialen Öffentlichkeit.
Nun hat es ja sein Gutes, daß ein ambitionierter Staat wie die Bundesrepublik in Rabat wie in anderen afrikanischen Staaten einen autokratisch regierenden Vasallen (samt einer ihm verpflichteten formellen Regierung) sitzen hat, der deutsche Anträge versteht und wohlwollend, das heißt auf Kosten seiner eigenen Bevölkerung und der der Entwicklung des Landes – wie sollte es sich entwickeln, wenn man die Fachkräfte abwandern läßt? Oder soll mit dem Entwicklungsministerium gar Deutschland entwickelt werden? — das umzusetzen verspricht, was von ihm gefordert wird.
Das war nicht immer so. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts war Marokko sehr umstritten. Zwar gab es auch damals einen Sultan, aber um den hatten sich die imperialistischen Staaten nicht groß geschert, wie sie sich ja überhaupt über die Köpfe der Afrikaner hinwegsetzen zu können glaubten. Kurzum, Afrika war damals aufgeteilt, hauptsächlich unter die beiden Großkolonialisten Großbritannien und Frankreich. Deutschland hatte ebenso große Ansprüche, wähnte sich aber gegenüber den anderen bei der Aufteilung jenes Kontinents zu kurz gekommen zu sein. Jedenfalls erachtete dies das deutsche Kaiserreich damals für einen nicht länger hinnehmbaren Zustand. Marokko, auf das Frankreich nächstliegende Ansprüche erhob – es hatte Westafrika ja größtenteils unter seiner Kontrolle, sollte, so Deutschland den Franzosen keineswegs überlassen werden. Es war Krieg zwischen Deutschland und Frankreich zu befürchten, da keine Seite nachgeben wollte. Am 3. April 1906 einigten sich schließlich die Parteien – neben Frankreich und Deutschland waren auch Spanien, Großbritannien, die USA, Österreich-Ungarn, Italien, Rußland, die Niederlande sowie Marokko selber vertreten –, den Krieg dann doch scheuend im Vertrag von Algeciras nach langwierigen Verhandlungen. Rein formell wurde Marokko Souveränität zugebilligt, die dort verfügten Reformen wurden unter internationale Aufsicht gestellt, die organisierende Polizei wurde an Frankreich und Spanien übertragen. Internationale Handelsfreiheit wurde sichergestellt und zwar ›gleichmäßig‹, was heißen soll: auf alle Staaten entsprechend verteilt. Die Aufsicht darüber wurde einem diplomatischen Korps in Tanger übertragen. Dieses Ergebnis war für die deutschen Ansprüche selbstredend ziemlich erbärmlich.
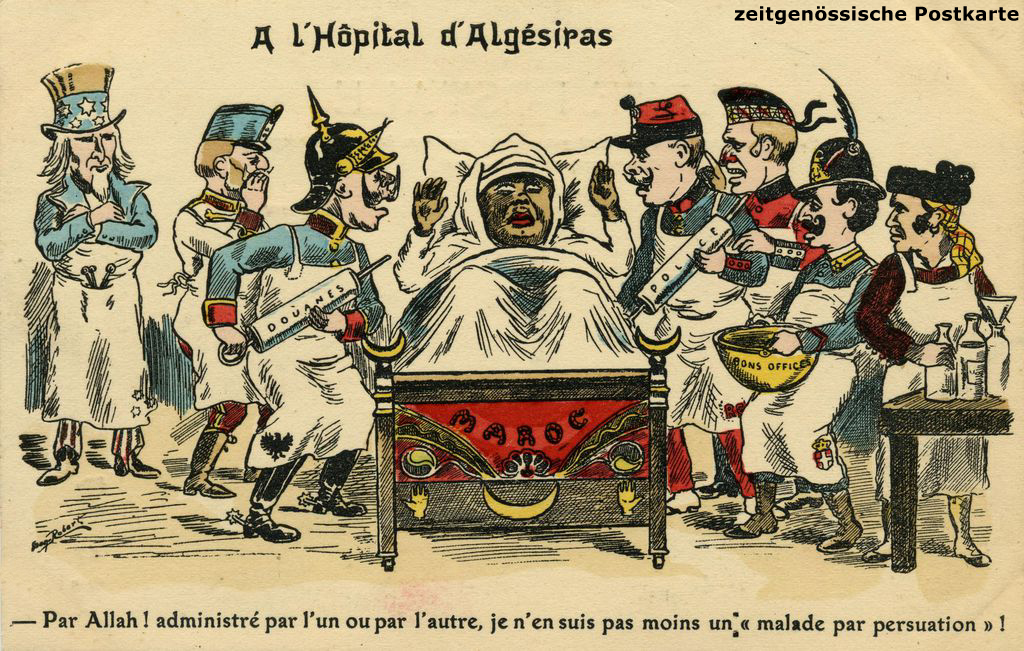 Und so dauerte es nicht allzu lange, bis es zur 2. Marokkokrise kam. Im April 1911 kam es ob der Eintreibungen von Tributen zu Unruhen durch Einheimische. Deshalb nahm Frankreich eine Expedition in die damalige marokkanische Hauptstadt Fez [auch geschrieben: Fès] vor (Einmarsch am 21.05.), gleichzeitig beschwichtigend, es handele sich nicht um eine Verletzung des 1906 geschlossenen Vertrags. Das sah man in Deutschland anders, zumal Frankreich zunächst keinen Rückzugstermin bekannt geben wollte und später Ausbilder für die marokkanischen Streitkräfte im Lande behalten wollte. Daraufhin wurde der Panzerkreuzer ›Panther‹ vor den besten Atlantikhafen Marokkos, Agadir, geschickt (später abgelöst durch einen namens ›Berlin‹). Nach langwierigem internationalen Gezerre wurde letztendlich noch einmal ein Krieg verhindert. Deutschland erkannte Marokko am 04.11.2011 als Protektorat Frankreichs an und erhielt im Gegenzug ein beträchtliches Gebiet des französischen Kongos – welches die deutsche Kolonie Kamerun, die daran anschloß, fast verdoppelte –, wenngleich der wirtschaftliche Nutzen wenig vielversprechend erschien. Außerdem erhielt es ein Vorkaufsrecht auf das spanische Guinea (heute: Äquatorial-Guinea). Es war einmal mehr klar, daß, wiewohl Deutschland nicht leer ausgegangen war, das für mager angesehene Resultat die Empörung deutscher Nationalisten hervorrief.
Und so dauerte es nicht allzu lange, bis es zur 2. Marokkokrise kam. Im April 1911 kam es ob der Eintreibungen von Tributen zu Unruhen durch Einheimische. Deshalb nahm Frankreich eine Expedition in die damalige marokkanische Hauptstadt Fez [auch geschrieben: Fès] vor (Einmarsch am 21.05.), gleichzeitig beschwichtigend, es handele sich nicht um eine Verletzung des 1906 geschlossenen Vertrags. Das sah man in Deutschland anders, zumal Frankreich zunächst keinen Rückzugstermin bekannt geben wollte und später Ausbilder für die marokkanischen Streitkräfte im Lande behalten wollte. Daraufhin wurde der Panzerkreuzer ›Panther‹ vor den besten Atlantikhafen Marokkos, Agadir, geschickt (später abgelöst durch einen namens ›Berlin‹). Nach langwierigem internationalen Gezerre wurde letztendlich noch einmal ein Krieg verhindert. Deutschland erkannte Marokko am 04.11.2011 als Protektorat Frankreichs an und erhielt im Gegenzug ein beträchtliches Gebiet des französischen Kongos – welches die deutsche Kolonie Kamerun, die daran anschloß, fast verdoppelte –, wenngleich der wirtschaftliche Nutzen wenig vielversprechend erschien. Außerdem erhielt es ein Vorkaufsrecht auf das spanische Guinea (heute: Äquatorial-Guinea). Es war einmal mehr klar, daß, wiewohl Deutschland nicht leer ausgegangen war, das für mager angesehene Resultat die Empörung deutscher Nationalisten hervorrief.
Und damit wären wir bei der innenpolitischen Auseinandersetzung in Deutschland. Der Schriftsteller Arthur Zapp, ein aufmerksamer Beobachter des Zeitgeschehens, hat gerade angesichts der immensen Kriegsgefahr anläßlich der Marokko-Krise einen aufschreienden Roman verfaßt. Der war so antinationalistisch und antimilitaristisch, daß er nur unter einem Pseudonym (V. E. Teranus) veröffentlicht werden konnte (Verlag Continent G.m.b.H. Berlin W 50). Die Schrift trägt den Titel ›Der letzte Krieg‹: Damals nahm Zapp an, daß die Menschheit mit dem anstehenden Krieg noch zur Einsicht kommen könnte. Dies hatte er dann nach dem Weltkrieg revidiert, er hielt noch zwei weitere Weltkriege für nötig, wie er in seinem der Zukunft gewidmeten Roman ›Revanche für Versailles! – Eine Zukunftsvision (1924)‹ kundgab. ›Der letzte Krieg – ein Zukunftsbild‹ wurde während Beendigung der 2. Marokkokrise geschrieben, vielleicht auch schon vor der sich zusammenbrauenden Krise (im Buch selber ist keine Jahreszahl enthalten). Das Werk stellt einen eindringlichen Aufschrei gegen die Kriegshetze in Deutschland dar. Gerade deshalb verdient es noch heute angesichts von Aufrüstung und Kriegshetze, der Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und an Diktatoren, ja selbst der Kanonenbootpolitik (jüngst im Roten Meer) der deutschen, sozialdemokratisch geführten Regierung höchste Relevanz!
Hier seien zwei Kapital des heute nicht mehr erhältlichen Romans dokumentiert, und zwar der 1. Abschnitt des 2. Kapitels mit der Rede des Reichskanzlers (Theobald von Bethmann Hollweg) und der Gegenrede von August Bebel, dem Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten sowie das 3. Kapitel mit der sozialdemokratischen Parteiversammlung, in der der Referent den Opportunismus Bebels zerlegt.
Bei dem Kritiker sei angemerkt, daß, wiewohl er an Schärfe nichts zu wünschen übrig läßt, doch einige schwache Stellen erkennbar werden: So verteidigt er den Rechtsstaat in seinem Verständnis als einen Gegensatz zum Militarismus – ein solches Mißverständnis kann heutzutage sicher nicht mehr aufkommen. Zum anderen spricht er immer vom ›Volk‹, wiewohl er die Arbeiterklasse meint. Damit bestätigt er den Wunsch nach einer dezidiert proletarischen Führung, anstatt – er zitiert immerhin das ›Kommunistische Manifest‹ – der Emanzipation der Arbeiterklasse das Wort zu reden.
Nichtsdestotrotz ist die Auseinandersetzung mit den damaligen Gegebenheiten aufschlußreich. Am Opportunismus der SPD hat sich jedenfalls nichts geändert. Als Führungskraft des Staates ist der Kriegswille der SPD heute allerdings nicht mehr wie damals bloß unzufriedene Opposition.
Doch nun zu den Ausschnitten des Romans, bei dem allein das in eckige [ ] Klammern Gesetzte eingefügt ist.
________________
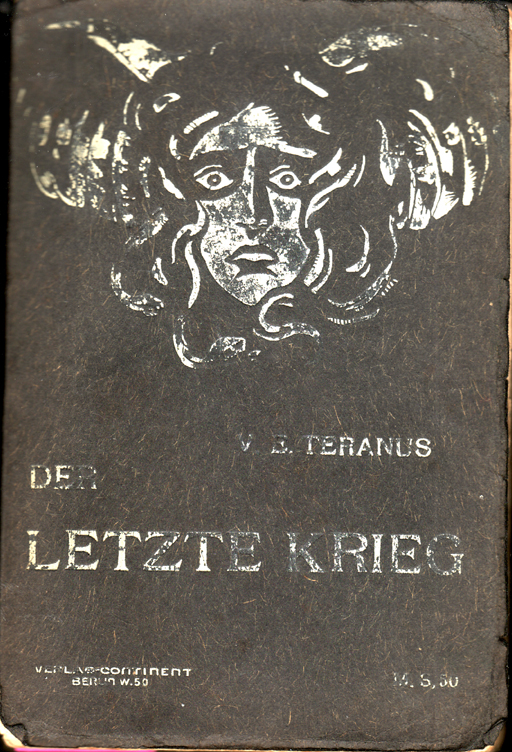 Die Nachrichten, die die Zeitungen am Morgen des sechsten Juli [1911] brachten, waren nichts weniger als beruhigend. Im Gegenteil, die Meldung von dem kriegerischen Einbruch französischer Truppen in Marokko wurde bestätigt und dann die Mitteilung geknüpft, daß im Auswärtigen Amt zu Berlin die ganze Nacht über gearbeitet worden und daß Depeschen hin- und hergeflogen seien. Auch die Nachrichten aus England lauteten alarmierend genug. Ein englisches Geschwader war von Helgoland aus gesichtet. Zu gleicher Zeit berichteten Telegramme von englischen Waffenlieferungen nach dem Balkan und von sonstiger englischer Minierarbeit. Augenscheinlich wollte das perfide »Albion« Bosnien gegen Österreich aufwiegeln und Serbien und Bulgarien mit in die Bewegung verwickeln. Daß zwischen England und Frankreich geheime Abmachungen getroffen waren, konnte als sicher gelten, denn niemals würde Frankreich den entscheidenden Schritt in Marokko, den Abmachungen von Algeciras zum Trotz, getan haben, wüßte es den Bundesgenossen nicht an seiner Seite.
Die Nachrichten, die die Zeitungen am Morgen des sechsten Juli [1911] brachten, waren nichts weniger als beruhigend. Im Gegenteil, die Meldung von dem kriegerischen Einbruch französischer Truppen in Marokko wurde bestätigt und dann die Mitteilung geknüpft, daß im Auswärtigen Amt zu Berlin die ganze Nacht über gearbeitet worden und daß Depeschen hin- und hergeflogen seien. Auch die Nachrichten aus England lauteten alarmierend genug. Ein englisches Geschwader war von Helgoland aus gesichtet. Zu gleicher Zeit berichteten Telegramme von englischen Waffenlieferungen nach dem Balkan und von sonstiger englischer Minierarbeit. Augenscheinlich wollte das perfide »Albion« Bosnien gegen Österreich aufwiegeln und Serbien und Bulgarien mit in die Bewegung verwickeln. Daß zwischen England und Frankreich geheime Abmachungen getroffen waren, konnte als sicher gelten, denn niemals würde Frankreich den entscheidenden Schritt in Marokko, den Abmachungen von Algeciras zum Trotz, getan haben, wüßte es den Bundesgenossen nicht an seiner Seite.
Wie Rußland und wie Italien sich in dem drohenden Konflikt verhalten würden, war die große Frage, deren Lösung alle Welt mit Spannung entgegensah.
Überall, in den öffentlichen Bureaus, in den Comptoirs, in den geschäftslokalen aller Branchen, in den Werkstätten der Handwerker, auf den Arbeitsplätzen, ja sogar in den Schulen wurde lebhaft über die Frage: Krieg oder Frieden diskutiert.
Die Abendblätter brachten die Nachricht, daß die deutsche Regierung in sehr entschiedenem Ton ein Ultimatum an Frankreich gerichtet und unter Berufung auf die Abmachungen von Algeciras die sofortige Zurückziehung der französischen truppen aus Marokko gefordert habe. Im Reichtstag habe große Begeisterung geherrscht; von fast allen Seiten des Hauses sei die energische Erklärung des Reichskanzlers mit jubelndem Beifall aufgenommen worden.
Der Antrag Bebel und Genossen: der Reichtstag möge die Erwartung aussprechen, daß sich die Regierung auf keinen Fall auf kriegerische Abenteuer einlassen werde, selbst wenn sich das Gerücht von der Okkupierung Marokkos durch die Franzosen bestätigen sollte, sei mit stürmischen »Pfuis« abgelehnt worden.
Schließlich war die Diskussion vertagt und dem Reichskanzler mit allen Stimmen gegen die der Sozialdemokraten das volle Vertrauen ausgesprochen worden.
Am 10. Juli herrschte »Unter den Linden« und in den Straßen der Friedrichsstadt vom frühen Morgen an ein lebhaftes Leben und Treiben. Die Morgenblätter hatten ausführlich über eine im französischen Parlament stattgefundene Sitzung berichtet, in der der leitende Minister unter dem begeisterten Beifall fast aller Abgeordneten eine sehr kriegerisch gestimmte Rede gehalten und Deutschland sehr verächtlich ein geknechtetes, selbstherrlich regiertes Land genannt hatte, das den Heeren der freien Republik nicht würde standhalten können.
Nur die Sozialisten hatten einen Mißklang in den einhelligen Enthusiasmus, in den hochaufschäumenden Patriotismus der anderen gebracht.
Jaurès hatte in einer großen Rede seinen und seiner Genossen Standpunkt dargelegt.»… Der ökonomische Konkurrenzkampf zwischen dem Kapitalismus hüben und drüben, die Gewinnsucht, das Bedürfnis, um jeden Preis, auch mit Kanonenkugeln, der überfüllten und in ihrer eigenen Unordnung erstickenden kapitalistischen Produktion immer wieder neue Absatzquellen zu eröffnen, ist es, was den Krieg entfesselt. Der Krieg ist nur der sichtbare Ausbruch des in allen Gängen und Adern unsrer Erdrinde fortschwelenden Feuers, des chronischen und schweren Fiebers, das unser gesellschaftliches Leben fortwährend untergräbt. … Wir, das arbeitende, friedliebende Volk protestieren gegen den Krieg, wir fühlen uns eins mit unseren arbeitenden Brüdern jenseits unsrer Landesgrenzen. Uns eint ein Wille, der Gedanke an die Solidarität alles dessen, was Menschanantlitz trägt. …«
Guesde und Vaillant hatten ihrem Genossen sekundiert; ihre flammenden, gegen den Krieg eifernden und den Bürgerkrieg in Aussicht stellenden Worte waren aber schließlich in dem zornigen Widerspruch, in dem wütenden Tumulte der überwältigenden Mehrheit des Hauses erstickt.
Zum Schluß der Sitzung war dem Ministerium mit allen gegen zwanzig Stimmen das volle Vertrauen des Parlaments votiert und die Erwartung ausgesprochen worden, daß die Regierung sich durch das drohende Ultimatum der deutschen Regierung nicht einschüchtern, sondern die Interessen Frankreichs in Marokko unbeirrt weiter verfolgen werde. …'
Der Krieg war nunmehr unvermeidlich. Das war die allgemeine Ansicht, der die dichten Menschenmassen, die auf beiden Seiten der Prachtstraße »Unter den Linden« und auf der Mittelpromenade hin- und herwogten, eifrig schwatzenden und gestikulierend, Ausdruck gaben. Vor dem Schlosse hatte sich eine große Menge angestaut, die sich nicht rückte und rührte und stundenlang mit bewundernswerter Ausdauer aushielt und neugierig, erwartungsvoll nach dem unzähligen Fenstern des Riesengebäudes starrte, als müsse sich dort irgend etwas Wunderbares ereignen.
Ausrufe, hastige Mitteilungen, Meinungsäußerungen, die mit großer Wichtigkeit abgegeben wurden, schwirrten hin und her. Die Gerüchte, die von klugen Leuten, die das Gras wachsen hörten, eifrig kommentiert wurden, wuchsen ins Ungeheuerliche. Eine große englische Flotte habe Cuxhaven beschossen, ja eine englische Truppenmacht sie im Begriff, an deutscher Küste zu landen. Eine französische Armeeabteilung sei bereits in Lothringen eingerückt und marschiere auf Metz los. Auch ein russisches Armeekorps habe schon die Grenze überschritten und sei in Westpreußen eingebrochen. Italien habe sich ebenfalls dem Feinde angeschlossen und eine italienische Flotte blockiere Triest und Pola [=Pula]…
Trotz aller Lebhaftigkeit herrschte eine gedrückte, bange Stimmung. Das war nicht die siegesgewisse Begeisterung von 1870, wo man wußte, daß man nur die schlecht gerüstete Armee des desorganisierten französischen Kaiserreichs gegen sich hatte, während es jetzt hieß: Feinde ringsum! Außerdem war seit Jahren bekannt, daß die französische Armee sich in vortrefflichstem Zustand befand und vollständig kriegsbereit war.
Deutschland aber hatte allein auf die Österreicher als Bundesgenossen zu rechnen. Dazu kam, daß man keine populären bewährten Heerführer besaß, wie 1870, daß noch keiner der Generäle im Ernstfalle Proben seiner Tüchtigkeit hatte geben können. Der allgemein vorherrschende Pessimismus machte sich nach Berliner Weise in allerlei schnoddrigen Bemerkungen Luft: »Schlummerköppe! Immer langsam voran, daß die österreichische Landwehr nachkommen kann!«
»Der Reichskanzler hat die Zeit verschlafen. Ja, wenn wir Bismarck‘n noch hätten, der wär‘ längst mit‘n Donnerwetter dreingefahren!« »Jawohl, der stand früh auf.«
»Und Moltke‘n! Und Roon‘n Und Prinz Friedrich Karl‘n! Und den Kronprinzen! Unsern Fritz! Und Werder! Und Alvensleben! Ei weih!«
»Wen haben wir denn nu? Nich mal `n Walderfee haben wir mehr!« »Jawohl, die scheenste Keile kriegen wir nu – paßt mal uff!« ……
Die Tribünen im Reichstag, der von einer vieltausendköpfigen Menge umlagert war, waren längst vor Eröffnung der Sitzung überfüllt. Als um 11 Uhr der Wagen des Reichskanzlers vorfuhr, reckte alles die Hälse. Ein paar Hochs wurden rasch durch laute Äußerungen des Unwillens erstickt.
Im Sitzungssaal trat beim Erscheinen des obersten Reichsbeamten plötzlich erwartungsvolle Stille ein.
Der Reichskanzler nahm sofort das Wort: »Meine Herren, wichtige Ereignisse sind seit gestern geschehen. Die Feindseligkeiten sind, wie wir nicht anders erwartet haben, von seiten der Engländer begonnen worden. Zahlreiche bei uns eingelaufene Meldungen besagen, daß eine ganze Anzahl von deutschen Dampfern und Segelschiffen auf der Nordsee und im Kanal von englischen Kreuzern gekapert worden –«
Stürmische Entrüstungsrufe unterbrachen den Redner. Man sah einander mit zornrotem Gesicht, mit sprühenden Augen an.
Nach kurzer Pause fuhr der Reichskanzler fort: »Der große herrliche Palast-Dampfer ›Deutschland‹ der Hamburg-Amerika-Linie und der nicht minder prächtige Schnelldampfer ›Kaiser Wilhelm der Große‹ des Norddeutschen Lloyd sind auf der Höhe von Southampton von den Engländern angehalten und gewaltsam in den Hafen geschleppt worden –«
Neue zornige Unterbrechungen, Wut- und Entrüstungsschreie.
»Kurz, meine Herren,« nahm der Reichskanzler seine Rede mit erhöhter Stimme wieder auf, »der Krieg ist von unseren Gegnern begonnen, frivol vom Zaun gebrochen worden und uns bleibt nichts übrig, als der Gewalt die Gewalt entgegenzusetzen und unsrer verletzten nationalen Ehre mit allem Nachdruck, mit aller Energie, mit aller Rücksichtslosigkeit Genugtuung zu verschaffen –«
Tosendes Bravorufen erscholl, das sich immer wieder erneute und minutenlang anhielt. Endlich vermochte sich der Reichskanzler, von der Präsidentenklingel unterstützt, wieder Gehör zu verschaffen. Er teilte unter lautloser Aufmerksamkeit, die allerdings von Zeit zu Zeit durch Kundgebungen des Beifalls und begeisterte Zustimmung, bzw. durch Äußerungen der Empörung unterbrochen wurde, mit, daß die französischen Ostkorps zwar gerüstet an der Grenze stünden, sonstige feindselige Handlungen aber noch nicht begonnen hätten. Auch die deutsche Heeresleitung sei nicht müßig gewesen. Die westlichen Grenzkorps seien bereits mobil gemacht und ständen in klirrender Rüstung bereit, einen Angriff zurückzuschlagen oder erforderlichenfalls selbst offensiv vorzugehen. Von Rußland seien Feindseligkeiten wenigstens vorläufig nicht zu erwarten. Das große östliche Nachbarreich werde seine definitive Haltung wohl einerseits von der Stimmung und den Zuständen im Lande und andrerseits von den Ereignissen auf dem Kriegsschauplatz abhängig machen. Italiens Verhalten sei zweifelhaft; irredentistische Putsche in Triest, die Äußerungen der Presse und enthusiastische Kundgebungen von Volksmengen vor dem Gebäude der französischen Gesandschaft in Rom und der französischen Konsulate in Mailand und Venedig bewiesen, daß die Volksstimmung den deutschen Bundesgenossen feindlich und den Franzosen freundliche gesinnt wäre. Man schien zu glauben, die Zeit sei gekommen, die italienischen Stammesbrüder vom österreichischen Joch zu befreien.
Weitere am Morgen eingegangene Nachrichten besagten, daß die französische Regierung wahrscheinlich in der heutigen Kammersitzung sich das Kriegsbudget votieren lassen werde. Außerdem habe er — der Reichskanzler – kurz vor der Abfahrt nach dem Reichstag ein Telegramm aus Paris erhalten, das besage, daß die Führer der französischen Sozialisten: Jaurès, Guesde, Vaillant und andere in aller Frühe verhaftet worden seien, wahrscheinlich um sie an weiteren Agitationen gegen den Krieg zu verhindern und wohl auch weil man hoffte, dem angedrohten Generalstreik entgegenzuarbeiten.
Diese Nachricht erregte allgemeine Sensation. Konservative und nationalliberale Volksvertreter riefen ein beifälliges: »Bravo! Sehr gut!« Aller Augen richteten sich nach der linken Seite des Hauses, wo die sozialistischen Abgeordneten sich um ihren Anführer Bebel geschart hatten und sich, sichtlich ernst und verstört, miteinander besprachen. Ein paar Heißsporne riefen sogar: »Auch so machen! Einsperren die Vaterlandsverräter!« dem Reichskanzler zu. Dieser aber schüttelte lächelnd den Kopf und, als wieder einigermaßen Ruhe eingetreten war, erwiderte er: »Nein, meine Herren, zu einer so gewaltsamen Maßregel haben wir uns nicht entschlossen und wir haben ja auch gar keinen Anlaß dazu. Herr von Vollmar und auch Herr Bebel und seine Freunde sind viel zu vernünftige Leute und sie empfinden trotz alledem viel zu patriotisch, als daß sie der Regierung bei der Erfüllung ihrer Pflicht, das Vaterland gegen die Angriffe der Feinde zu verteidigen, in den Rücken fallen würden –«
»Aber die Franzosen haben uns ja noch gar nicht angegriffen,« rief der greise Führer der Sozialisten mit der ihm eigenen jugendlichen Lebhaftigkeit dazwischen.
»Allerdings angegriffen haben sie uns noch nicht, Herr Bebel,« replizierte der Reichskanzler mit erhobener Stimme, sich mit ernstem Gesicht, das eine lebhafte innere Bewegung widerstrahlte, nach der linken Seite des Hauses wendend. »Aber sie haben unser Ultimatum, das wir wegen ihres eigenmächtigen Vorgehens gegen Marokko an sie richteten, in — ich kann wohl sagen in einem unerhört herausfordernden Ton beantwortet, der einer Kriegserklärung gleichkommt.«
Der Reichskanzler hob ein vor ihm liegendes Blatt empor und las mit weithin schallender Stimme den Wortlaut der von der französischen Regierung eingegangenen Depesche vor. Ein ohrenbetäubender Lärm brach los; wie ein Sturm brauste es durch das ganze Haus; auch überall von den Tribünen stimmte man in die lauten Zornesrufe, in die wilden Schreie ein: »Infam! Frechheit! Hauen müssen wir sie, wie 1870. Krieg! Krieg!«
Alle Abgeordneten waren von ihren Sitzenaufgesprungen und gestikulierten lebhaft nach dem Bundesratstisch hinauf, an dem der Reichskanzler abwartend stand und mir freudig erregtem Gesicht in den Tumult starrte.
Von den Tribünen wehten Damen enthusiastisch mit den Taschentüchern.
Da rief plötzlich eine Stimme von der Linken in den Lärm: »Was geht uns Marokko an!« Wütende Pfuirufe beantworteten von der rechten Seite des Hauses den Zwischenruf. Der Reichskanzler aber winkte abwehrend mit der Hand und erwiderte, als sich endlich die Aufregung etwas gelegt hatte mit dem Pathos sittlicher Entrüstung:
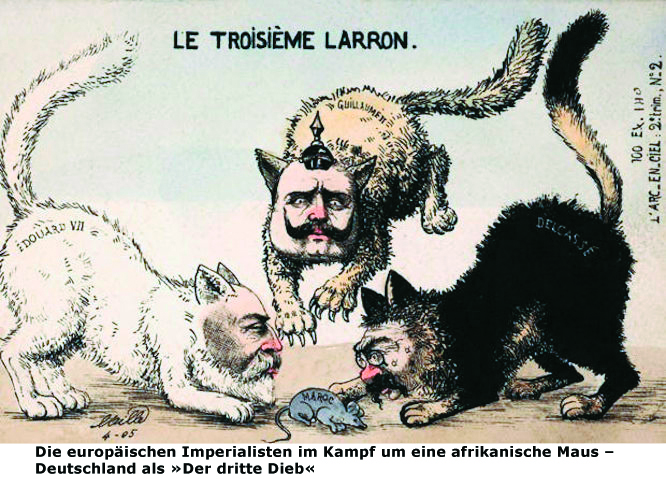 »Dem Herrn, der den eben gehörten Zwischenruf ausgestoßen, erwidere ich: die Zeit, wo sich Deutschland überall im Auslande zurückdrängen ließ, ist vorbei. Wir haben Interessen in Marokko und wir werden sie mit aller Energie verteidigen – (»Bravo! Bravo!«) Überdies wird jeder, der Augen hat zu sehen und sie nicht geflissentlich vor den Tatsachen verschließt, die Überzeugung gewonnen haben, daß der Krieg gegen uns eine zwischen England und Frankreich längst abgekartete Entschließung ist.
»Dem Herrn, der den eben gehörten Zwischenruf ausgestoßen, erwidere ich: die Zeit, wo sich Deutschland überall im Auslande zurückdrängen ließ, ist vorbei. Wir haben Interessen in Marokko und wir werden sie mit aller Energie verteidigen – (»Bravo! Bravo!«) Überdies wird jeder, der Augen hat zu sehen und sie nicht geflissentlich vor den Tatsachen verschließt, die Überzeugung gewonnen haben, daß der Krieg gegen uns eine zwischen England und Frankreich längst abgekartete Entschließung ist.
Sollen wir uns wehrlos überfallen lassen? Sollen wir warten, bis das feindliche Heer bei uns eingerückt ist? Nein, meine Herren, das kann niemand, das können nicht einmal die Herren Sozialisten vom Kaiser und von der Regierung verlangen!«
Des Reichskanzlers Gesicht nahm einen tiefernsten Ausdruck und zugleich eine dunklere Färbung an, seine Augen blitzten, und mit lauter, vor innerer Bewegung bebender Stimme rief er in die Versammlung: »Die Mobilmachung ist angeordnet. Der Telegraf hat den kaiserlichen Befehl bereits in alle Gaue des Reiches hinausgetragen. Der Krieg ist erklärt!«
Im ersten Augenblick herrschte eine Totenstille in dem weiten Raum. Vor der Gewißheit des furchtbaren Ereignisses, das alle Welt seit Jahren gefürchtet, das mehr als einmal in den letzten Jahrzehnten gedroht, schienen alle zu erstarren. Das Ungeheuerliche, dessen herankommen seit langem auf allen wie ein Alb gelastete, das viele abenteuerlustig, ehrgeizig oder aus niedrigen Motiven ersehnt, das den meisten aber doch Furcht und Entsetzen eingeflößt hatte, war da: der Weltkrieg! Aller Herzschlag schien für einen kurzen Moment auszusetzen und allen schien die Ahnung entsetzlicher Geschehnisse, riesenhafter Katastrofen sekundenlang den Atem geraubt zu haben. Dann aber brach von neuem betäubender Lärm los und donnernde Hurrarufe erschallten auf allen Seiten des Hauses und schienen immer neues Echo zu wecken. Als sich die allgemeine Erregung genug getan, richteten sich wieder alle Augen erwartungsvoll auf den Kanzler.
»Meine Herren,« nahm dieser von neuem das Wort: »Ich habe ihnen nur noch den Antrag der Verbündeten Regierungen vorzulegen, einen Kredit von 1200 Millionen Mark für das Heer und von 100 Millionen für die Flotte zu bewilligen und Sie zu bitten, unsre notgedrungene Forderung einstimmig zu bewilligen, um damit überzeugend vor aller Welt zu bekunden, daß Kaiser und Volk, ebenso wie vor dem glorreichen Feldzug von 1879, so auch diesmal und immer in schweren Tagen einig und treu zusammenstehen –«
Wieder wurde der Redner von allen Seiten des hauses durch stürmischen Beifall unterbrochen, der auch auf den Tribünen ein jubelndes Echo fand.
Endlich verschaffte die Glocke des Präsidenten dem Kanzler die Möglichkeit, seine Rede zum Abschluß zu bringen.
»Ja, meine Herren, ich habe die feste Zuversicht, daß ihr Votum einstimmig erfolgt und daß auch die Herren der äußersten Linken in Konsequenz früherer Erklärungen ihrer Wortführer« – auf die letzten Worte legte der Redende einen besonderen Nachdruck, der in den Reihen der konservativen und liberalen Abgeordneten ein vielstimmiges: »Hört! Hört!« hervorrief – »sich diesmal von der Einigkeit des Hauses nicht ausschließen werden. Wiederholt haben die beiden anerkannten Vertreter der Sozialdemokratie, der norddeutsche Herr Bebel und der süddeutsche Herr von Vollmar Gelegenheit genommen zu erklären, daß die Vaterlandsliebe für sie kein leerer Begriff ist und daß sie gewisse Fragen nicht vom Standpunkt internationaler Solidarität, sondern von dem nationaler Unabhängigkeit beurteilen werden. Wiederholt haben sie erklärt, daß die Sozialisten im Heere ebensogut und ebenso begeistert wie alle übrigen Soldaten ihre Pflicht tun würden, wenn es sich darum handelte, die nationale Selbständigkeit gegen Angriffe von außen zu verteidigen. (»Hört! Hört!« und »Bravo!« rechts und in der Mitte.) So hat einmal Herr von Vollmar im bayrischen Landtag – es war im Sommer 1906 – eine ganze Rede über Patriotismus und Sozialdemokratie gehalten und sich und seine partei aufs allerschärfste und nachdrücklichste gegen den Vorwurf der Vaterlandslosigkeit und Animosität gegen das Heer verteidigt. Er hat bei dieser gelegenheit unter anderem wörtlich gesagt –« der Redner hob ein vor ihm auf dem Tisch liegendes Blatt zu seinen Augen empor, während die um die Stufen zum Bundesratstisch gescharten Abgeordneten und die weiter hinten Stehenden die Köpfe vorstreckten und mit angespanntester Aufmerksamkeit lauschten, um sich kein Wort entgehen zu lassen – ›Wer also,‹ so hat der sozialistische Abgeordnete gesagt, ›wer also ein gegner des jetzigen Militärsystems ist, der ist deshalb noch lange kein Feind des Heeres selbst, desjenigen Heeres, das ja Blut von unsrem Blut und das die eigentliche Manneskraft unsres Volkes darstellt‹ – (»Bravo, bravo!«) Und weiter,« fuhr der Kanzler fort, »hat Herr von Vollmar den Vorwurf der Vaterlandslosigkeit mit besonderer Entrüstung, mit wuchtigen, kraftvollen Worten abgelehnt: ›und ich möchte auch denjenigen sehen, der z. B. mir die infame Beschimpfung der Vaterlandslosigkeit persönlich ins Angesichts schleudern wollte, er würde eine Antwort bekommen, die er niemals vergißt, das gebe ich schriftlich.‹ Nun meine Herren« – der Redner ließ das Blatt sinken und kehrte seinlächelndes Gesicht dem Hause zu: »energischer, schärfer, empörter könnte auch ich mich nicht gegen den Vorwurf kein Patriot zu sein verteidigen.«
Schallendes Bravo von allen Seiten, Gelächter und Händeklatschen.
»Herr von Vollmar,« fuhr der Kanzler schmunzelnd fort, »wird nun wissen, was er seiner Ehre und Pflicht als Patriot schuldet.«
Wiederholtes Lachen und Händeklatschen.
»Schließlich hat Herr von Vollmar bei dieser Gelegenheit vorwurfsvoll seinen Angreifern im bayrischen Landtag noch gesagt: ›Erklären dagegen unsre Redner im Reichstag, in diesem Hause oder sonstwo ihre Liebe zum Vaterland (»Hört! Hört!«) und ihre Bereitwilligkeit zu dessen Verteidigung (stürmisches »Hört! Hört! Bravo!«), so hat es gehießen: O das glauben wir nicht –‹ Nun, Herr von Vollmar, ich glaube Ihnen, ich zweifle nicht an Ihrer Vaterlandsliebe, ebensowenig wie an der Ihres Freundes Bebel, der ja ebenfalls wiederholt, zuletzt im Frühjahr 1906 bei Gelegenheit der Debatten zum Militäretat im Reichstag erklärt hat, daß auch die sozialistische Jugend freudig dem Rufe zu den Waffen folgen würde, wenn es gälte, das Vaterland zu verteidigen und daß er – Bebel – selbst in einem solchen Falle die Muskete auf seine alte Schultern nehmen würde.«
Stürmisches Bravorufen folgte den letzten mit erhobener Stimme in den Saal gerufenen Worten.
»Und bei einer anderen Gelegenheit,« schloß der Kanzler, »im Januar desselben jahres äußerte Bebel zu einem Vertreter des ›Peuple‹, des führenden sozialistischen Parteiorgans in Belgien, sich gegen den internationalen Generalstreik als Abwehrmittel eines Krieges aussprechend: ›Hier werden Fragen berührt‹, sagte Bebel, ›die Ihr Belgier, weil Ihr eine patriotische Tradition im eigentlichen Sinne nicht habt, auch nicht einmal ahnungsweise beurteilen könnt. Ein Krieg brächte die Eventualität eines Verlustes Elsaß-Lothringens und des linken Rheinufers (»Sehr wahr! Sehr richtig!«) Es handelt sich hierbei um eine Frage nationaler Unabhängigkeit, die auf alle anderen Fragen ihre Wirkung übt, die unwiderstehlich das Proletariat an die Grenzen treibt, um die nationale Integrität oder einfacher gesagt: um seine eigne Haut zu verteidigen!‹ (»Sehr wahr! Sehr richtig!«) Nun ja« – der Redner legte wieder das Blatt aus der Hand und sah lächelnd zu der Linken hinüber – »nun ja, Herr Bebel, ganz meine Ansicht: jetzt handelt es sich in der Tat um unsre nationale Selbständigkeit und Unabhängigkeit. Rufen Sie darum Ihren Genossen überall im Reiche zu: An die Grenzen zur Verteidigung des Vaterlandes! Und Sie selbst, Herr Bebel, beweisen Sie den Mut Ihrer Überzeugung, bewilligen Sie uns in logischer Konsequenz ihrer eigenen Worte die Mittel, unsre Integrität zu bewahren und uns unserer Haut zu wehren!«
Der Reichskanzler setzte sich, während stürmisches Bravo- und Beifallsrufen sich mit schallendem Gelächter mischte. Aller Augen richteten sich erwartungsoll, herausfordernd nach der linken Seite, wo die sozialistischen Abgeordneten sich schon während der Rede des Reichskanzlers um Bebel und v. Vollmar geschart hatten, um eifrig miteinander zu beraten. Den erhitzten Gesichtern und den heftigen Gestikulationen war anzusehen, daß in der sozialdemokratischen Fraktion diesmal die gewohnte Einmütigkeit nicht herrschte. Bebel redete dringlich auf seine Genossen ein, die sich endlich seinem Willen zu beugen schienen.
Jetzt wandte sich Bebel zur Präsidentenbühne und bat um das Wort. Und während ihm das Wort erteilt wurde und er mit jugendlicher Raschheit zur Rednertribüne emporeilte, ging eine lebhafte Bewegung durch das ganze Haus und eine dichte Korona von Abgeordneten aller Parteien drängte sich um die Tribüne. In allen Mienen spiegelte sich die gespannteste Erwartung, das stärkste Interesse. Der anerkannte langjährige Führer der deutschen Sozialdemokratie legte ein paar Blätter, die er in der Hand gehalten hatte, vor sich auf das Rednerpult und begann: »Wir, mein Freund von Vollmar und ich, sind weit entfernt, das, was wir gesagt haben, verleugnen zu wollen. Jawohl, wir haben mehr als einmal betont, hier im Hause und anderswo, daß wir Sozialisten unser Vaterland ebensogut lieben, wie irgendwelche Angehörige andrer Parteien und daß wir nicht anstehen werden, erforderlichen Falles unsre Pflicht zu erfüllen und den letzten Blutstropfen für unsre nationale Existenz einzusetzen, beziehungsweise unsre wehrfähigen Genossen zu ermahen, mit den Waffen in der Hand jeden Angriff auf unser Vaterland abzuwehren –«
»Bravo, bravo!« erschallte es von allen Seiten des Hauses und von den Tribünen.
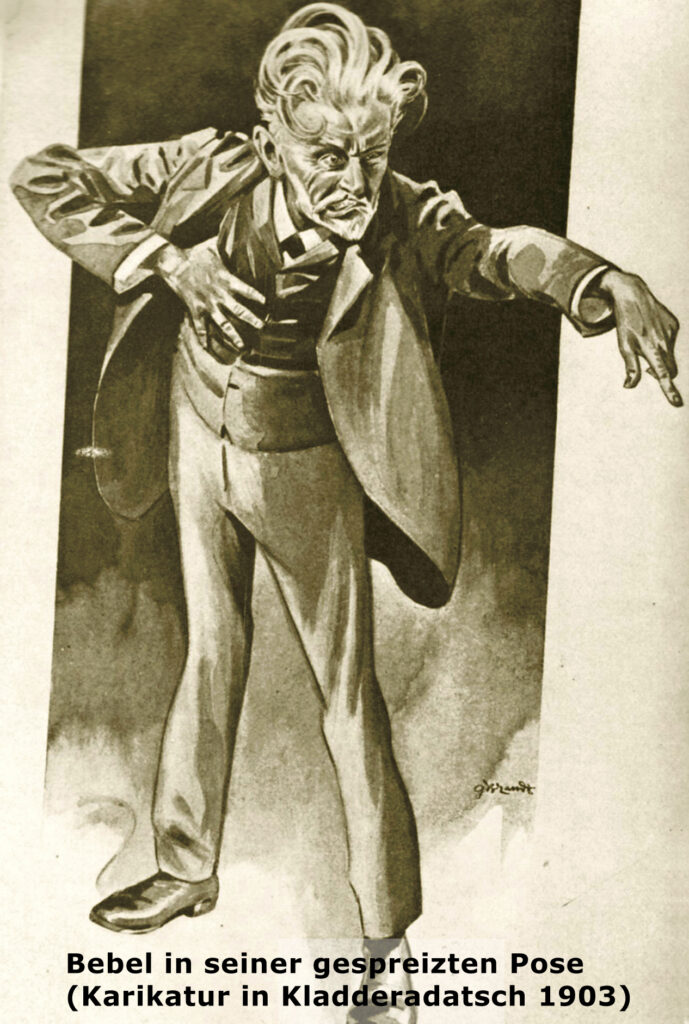 »Aber, meine Herren,« fuhr der Redner mit nervösem Zucken des Gesichts fort, offenbar nicht gerade sehr angenehm berührt von dem ihm zuteil werdenden ungewohnten einhelligen Beifall des Hauses, »aber, meine Herren, liegt denn hier ein solcher Fall vor?« (Gelächter. Stürmische Rufe: »Jawohl! Haben die Engländer nicht unsre Schiffe genommen?«)
»Aber, meine Herren,« fuhr der Redner mit nervösem Zucken des Gesichts fort, offenbar nicht gerade sehr angenehm berührt von dem ihm zuteil werdenden ungewohnten einhelligen Beifall des Hauses, »aber, meine Herren, liegt denn hier ein solcher Fall vor?« (Gelächter. Stürmische Rufe: »Jawohl! Haben die Engländer nicht unsre Schiffe genommen?«)
»Wenn die Engländer deutsche Schiffe gekapert haben, so haben sie damit allerdings den Krieg zur See begonnen – (»Na also«) den Krieg zur See, meine Herren! Aber sprechen wir zunächst einmal von der viel wichtigeren Frage des Landkrieges, mit dem uns Frankreich angeblich bedroht! (Gelächter.) Frankreich schickt sich an, Marokko zu okkupieren. Nehmen wir an, das sei richtig! Ja, meine Herren, haben wir uns denn von dem ganz brutalen, frivolen Einfall der Engländer in Transvaal zu einem Kriege gegen England, ja nur zu einem Protest bewegen lassen? Warum denn nun auf einmal Zeter und Mordio, wo es sich um ein viel unkultivierteres Land, um ein in der Kultur viel weiter zurückgebliebenes Volk handelt?« (Unruhe, Lachen, Rufen: »Das war etwas ganz anderes. Heute stehen wir auf einem andern Standpunkt.«) Sie stehen heute auf einem anderen Standpunkt. Wir aber nicht, meine Herren, wir sind noch immer der Meinung, daß ein Krieg nur erlaubt ist, wenn es sich um den Kampf für die Existenz handelt. Meine Herren, wenn ihre Nationalheros, den sie ja allezeit wie einen irrenden Gott verehrt haben, wenn Bismarck noch lebte, so würde ihm ein Konflikt mit Frankreich gerade so unsympathisch sein, wie er es uns ist.« (Gelächter. »Unsinn«)
»Nein, meine Herren, das ist kein Unsinn, sondern ich kann es Ihnen mit Bismarcks eigenen Worten belegen. In den Ihnen wohl allen bekannten Denkwürdigkeiten der Fürsten Hohenlohe – (Lachen) berichtet der Memoirenschreiber über verschiedene sehr charakteristische Äußerungen des ersten deutschen Reichskanzlers in dieser Hinsicht. So erzählt Fürst Hohenlohe im zweiten Band seiner Denkwürdigkeiten« – der Redner hob eins der vor ihm liegenden Blätter zu seinem Gesicht empor – »von einem Gespräch während eines Besuches bei Bismarck im Badeort Gastein am 6. November 1883. Fürst Hohenlohe schreibt: ›Er – Bismarck – war entrüstet über die Times-Artikel, die Frankreich gegen uns hetzen. Er will, daß dagegen in der Zeitung vorgegangen werde. Wir wollen, sagte er, von Frankreich nichts. Ein Krieg könnte uns nichts bringen. Geld wohl, aber deswegen führe man keinen Krieg. Franzosen hätten wir schon zu viel.‹ Soweit Bismarck. Sie aber, meine Herren, scheint‘s wollen noch mehr französisches Geld und noch mehr Franzosen – (Stürmische Unterbrechung: »Wollen wir nicht!«)
Nicht? Desto besser! Doch hören wir weiter! Im Jahre 1883 äußerte Bismarck in Friedrichsruh unter anderem: ›Wir haben gute Beziehungen zu Frankreich, die chauvinistischen Provokationen lassen wir unbeachtet und –‹ der Redner sah triumfierend zu der Zuhörerschaft zu seinen Füßen hinunter – ›und in der Kolonialpolitik fördern wir die Wünsche Frankreichs –‹« (Unruhe. Heftige Rufe: »Das hat er nicht gesagt.«) Der Redner hob sein Blatt und schwenkte es in der Luft: »Doch, meine Herren, das hat Ihr Abgott Bismarck gesagt! Und er hat sich noch viel klarer und schärfer in einem früheren Gespräch – es war am 7. November 1882 in Barzin – dem Fürsten Hohenlohe gegenüber über unser Verhältnis zu Frankreich ausgesprochen. Da sagte er: ›Wenn die Franzosen von den Engländern freie Hand in Syrien verlagen, so ist uns das gleichgültig. Überall sollen die Franzosen tun, was sie wollen, wenn sie nur vom Rhein fernbleiben.‹« (Stürmische Unterbrechungen: »Den wollen sie ja eben!«) »Hören Sie doch weiter, meine Herren,« fuhr der sozialistische Redner mit triumfierendem Lächeln fort. »Es kommt noch viel schöner. ›Abends lange Unterredung bei der Pfeife. Bismarck trug mir auf, St. Vallier seine Grüße auszurichten und ihm zu sagen, que nous le regrettons [daß wir es bereuen].‹ Hören Sie wohl, meine Herren« – der sozialdemokratische Parteiführer sah wieder auf sein Blatt: »›Im übrigen bleiben wir bei unsrer wohlwollenden Haltung … und erklären den Franzosen, daß wir sie nie bedrohen werden, auch wenn sie in Kalamitäten geraten sollten, solange sie vom Rhein fern bleiben.‹« Der Redner erhob wieder seine Stimme: »›Sie können in der Welt tun, was sie wollen.‹ So, meine Herren, hat Bismarck sich geäußert, der doch immer für sie maßgebend gewesen ist. Warum handeln Sie nun nicht nach seinem Rat, warum lassen Sie die Franzosen in Marokko nicht ruhig gewähren? Sie aber wollen des lumpigen Marokko wegen alle Schrecken eines europäischen Krieges entfesseln!« (Zwischenrufe: »Es handelt sich ja gar nicht um Marokko! Abgekartete Geschichte mit England.«)
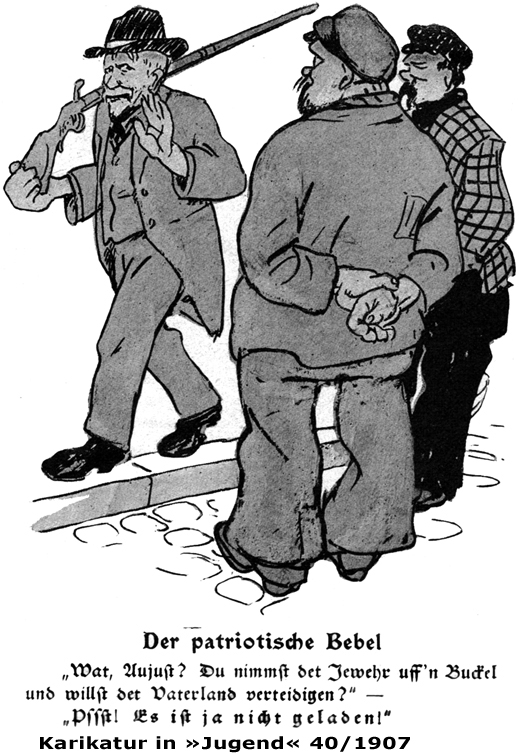 »Ja, meine Herren,« fuhr der Redner fort, »hier kommen wir zu einem dunklen Punkt, zu dem System der Geheimniskrämerei, mit der bei uns Fragen der auswärtigen Politik behandelt werden. Nicht vom Volk, obgleich dasselbe doch alle eventuellen Folgen zu tragen hat, nicht von den Vertretern des Volkes werden diese Fragen gelöst, sondern von einem halben Dutzend von Diplomaten. Wir andern aber tappen hier wie im Nebel herum und sind gar nicht in der Lage, uns ein klares Urteil bezüglich Schuld und Nichtschuld zu bilden. Wir wissen nicht und werden es vielleicht nie erfahren, wer für den drohenden Krieg verantwortlich ist, die Engländer, die Franzosen oder unsere Herren Staatsmänner. Wir haben ja alle staunend aus den Hohenloheschen Memoiren gesehen, wie leichtherzig, ja, wie frivol in den Hof- und Regierungskreisen mit dem Gedanken des Krieges gespielt wird und zwar nicht aus sachlichen Gründen, sondern oft haben Ursachen persönlicher Eifersüchtelei und persönlichen Interesses unsere leitenden Männer veranlaßt, in unsern Beziehungen zu auswärtigen Mächten eine schärfere Tonart anzuschlagen und Konflikte förmlich an den Haaren herbeizuziehen.
»Ja, meine Herren,« fuhr der Redner fort, »hier kommen wir zu einem dunklen Punkt, zu dem System der Geheimniskrämerei, mit der bei uns Fragen der auswärtigen Politik behandelt werden. Nicht vom Volk, obgleich dasselbe doch alle eventuellen Folgen zu tragen hat, nicht von den Vertretern des Volkes werden diese Fragen gelöst, sondern von einem halben Dutzend von Diplomaten. Wir andern aber tappen hier wie im Nebel herum und sind gar nicht in der Lage, uns ein klares Urteil bezüglich Schuld und Nichtschuld zu bilden. Wir wissen nicht und werden es vielleicht nie erfahren, wer für den drohenden Krieg verantwortlich ist, die Engländer, die Franzosen oder unsere Herren Staatsmänner. Wir haben ja alle staunend aus den Hohenloheschen Memoiren gesehen, wie leichtherzig, ja, wie frivol in den Hof- und Regierungskreisen mit dem Gedanken des Krieges gespielt wird und zwar nicht aus sachlichen Gründen, sondern oft haben Ursachen persönlicher Eifersüchtelei und persönlichen Interesses unsere leitenden Männer veranlaßt, in unsern Beziehungen zu auswärtigen Mächten eine schärfere Tonart anzuschlagen und Konflikte förmlich an den Haaren herbeizuziehen.
Wenn Bismarck selbst seinerzeit nicht vor der Eventualität des Krieges zurückschreckte, wie Hohenlohe an einigen Stellen seiner Denkwürdigkeiten berichtet, nur um sich und seinen Sohn um jeden Preis, auch um den des Krieges, im Amt zu erhalten, haben wir da nicht alle Veranlassung, auch die jetzigen Schwierigkeiten auf ähnliche persönliche Einflüsse, auf eigensüchtige Machinationen zurückzuführen?
Und in diesem Zweifel können wir auch nicht, wie der Herr Reichskanzler verlangt, für das Kriegsbudget stimmen.«
(Stürmische Unterbrechung: »Pfui! Eine Schmach! Pfui! Vaterlandsverräter!«)
Der Redner ließ den Unwillen, der sich auch auf den Tribünen fortpflanzte, austoben, dann fuhr er fort: »Ihre Schmähungen treffen uns nicht, wir sind ja daran gewöhnt, von Ihnen als vaterlandslos erklärt zu werden. Wenn der Krieg, den Sie unter keinen Umständen vermeiden zu wollen scheinen, vorüber sein wird, werden wir ja sehen, wer mehr auf das Wohl des Vaterlandes bedacht gewesen, wir, die wir den Krieg gern vermieden gesehen hätten, oder Sie. (Gelächter.) Wir sind grundsätzlich gegen jeden Krieg, dennoch würden wir, wenn wir klar erkennen würden, daß es sich darum handelt, unberechtigte Angriffe gegen uns abzuwehren, nicht anstehen, den von den Regierungen verlangten Kredit in vollem Umfange zu bewilligen. Andrerseits aber, weil wir eben nicht klar sehen, ob der Krieg von deutscher Seite unnötigerweise heraufbeschworen oder ob er uns aufgezwungen ist und weil ja die letztere Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, so wollen wir auch nicht gegen die Regierungsvorlage stimmen, sondern wir wollen in folgerichtiger Konsequenz unseres Zweifels aus der Abstimmung enthalten –.«
Im ersten Augenblick waren die Zuhörer offenbar überrascht und verdutzt infolge dieser unerwarteten Erklärung, dann aber brach ein betäubender Lärm los. Stürmisches Gelächter mischte sich mit Ausrufen der Entrüstung, Enttäuschung und Verachtung.
Endlich gelang es dem Redner, sich wieder Gehör zu verschaffen.
 »Sie selbst haben uns gezwungen zu dieser Haltung,« schrie er in die noch immer unruhige Versammlung hinein. Und sich dann gegen den Bundesratstisch wendend: »Wir haben zu dieser Regierung, die die Nation gerade da, wo es sich um ihre höchsten Interessen handelt, wie unmündige Kinder behandelt, kein Vertrauen. Wir ziehen nur die ganz logischen Konsequenzen Ihres Systems, nach welchem die ungeheure, verantwortungsvolle Entscheidung über Krieg und Frieden nicht, wie es sein sollte und wie es in anderen Kulturstaaten der Fall ist, bei dem Volke ruht, sondern an einer einzigen Stelle im Reich« – (»Schluß, Schluß«)
»Sie selbst haben uns gezwungen zu dieser Haltung,« schrie er in die noch immer unruhige Versammlung hinein. Und sich dann gegen den Bundesratstisch wendend: »Wir haben zu dieser Regierung, die die Nation gerade da, wo es sich um ihre höchsten Interessen handelt, wie unmündige Kinder behandelt, kein Vertrauen. Wir ziehen nur die ganz logischen Konsequenzen Ihres Systems, nach welchem die ungeheure, verantwortungsvolle Entscheidung über Krieg und Frieden nicht, wie es sein sollte und wie es in anderen Kulturstaaten der Fall ist, bei dem Volke ruht, sondern an einer einzigen Stelle im Reich« – (»Schluß, Schluß«)
»Ja ich komme zum Schluß. Ihre Vorwürfe weisen wir zurück: wir haben kein Interesse, das Reich wehrlos zu machen, im Gegenteil, wir geben ebenso bereitwillig wie Sie Gut und Blut für das Vaterland her, wenn wir die Überzeugung haben, daß man unsere nationale Existenz bedroht. Wir werden deshalb, da England ja die Feindseligkeiten zur See willkürlich, brutal, gewalttätig begonen hat, die für die Marine verlangten hundert Millionen bewilligen.«
Diese Erklärung, die der Majorität noch unerwarteter überraschender kam wie die frühere, wurde mit allgemeiner Verblüffung aufgenommen, die sich jedoch rasch in ein stürmisches Gelächter und in ein ironisches Bravorufen auflöste. Damit hatten sich die Hauptereignisse der denkwürdigen Sitzung vollzogen.
[…]
[Kapitel 3]
In den Riesensaal der ›Neuen Welt‹ in Berlin strömten ungeheure Menschenmengen. Ein starkes Aufgebot von Schutzleuten zu Fuß und zu Pferde hielt draußen mit üblicher schneidiger Geschäftigkeit die Ordnung aufrecht. Es mochten wohl an achtausend Arbeiter sein, die erwartungsvoll, lebhaft miteinander ihre Ansichten austauschend, der Ereignisse harrten. Die Tagesordnung der Versammlung, die von dem Aktionsausschuß der Verbandes der sozialdemokratischen Wahlvereinen von Groß-Berlin einberufen worden war, hatte starke Sensation in den Kreisen der Genossen hervorgerufen.
»Die Haltung unsrer Reichstagsfraktion in der Sitzung vom zehnten Juli.«
Daß die aufgrund dieser Tagesordnung einberufene Versammlung Notwendigkeit war, daß sie dem allgemeinen Wunsche der Genossen entsprach, darüber war nur eine Stimme. In der radikalen Arbeiterschaft Berlins hatte die Rede Bebels und das Verhalten der Fraktion bei der Abstimmung über den von der Regierung geforderten Kriegskredit viel böses Blut gemacht. Die allgemeine Empörung und Erbitterung war durch die Lokalisten und Anarcho-Sozialisten, die seit lange Bebels Verhalten in der Frage des Generalstreiks und des Kampfes gegen den Militarismus inkonsequent, schwächlich und opportunistisch nannten, nach Kräften geschürt worden. Der Umstand, daß inzwischen ein großer Teil der Arbeiter einberufen worden war, hatte natürlich nicht dazu beigetragen, die Gärung zu beschwichtigen.
Der Aktionsausschuß hatte sich deshalb dem allgemeinen immer stürmischer an ihn herantretenden Begehren nach einer Abrechnung mit den Abgeordneten der Partei, nach einer öffentlichen Kundgebung der allgemeinen Unzufriedenheit nicht länger verschließen können.
»Wird er kommen? Wird Bebel kommen?« raunte einer dem anderen ins Ohr. Ja, er kam! Durch eine Tür, die auf das Podium am Ende des Saales mündete, trat er ein, um auf einem der hier für die Eingeladenen, die Mitglieder der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion aufgestellten Stühle Platz zu nehmen.
Als man ihn erkannte, den schmächtigen, kaum halb großen Mann mit der noch immer dichten, weißgewordenen Haarmähne, ging eine lebhafte Bewegung durch die Menge und so groß war der Zauber seiner Persönlichkeit, so ungeheuer die Verehrung, die man dem großen Redner, dem greisen Volkstribunen entgegenbrachte, der so viele Jahrzehnte bereits für die Volksfreiheit gekämpft, der so viele glänzende Triumfe auf der Rednertribüne davongetragen hatte, daß die Tausende ihm auch jetzt noch zujubelten.
Ein stolzes Lächeln der Befriedigung, der Siegesgewißheit ging über das schmale blasse Gesicht, während er dankend zu der Menge hinabwinkte, die er in seinem Bann wußte, die sich noch immer gläubig, trotz aller Angriffe seiner Gegner, seiner Autorität gefügt hatte, gerade so unbedingt ergeben und widerspruchslos, wie nur je ein Selbstherrscher von seiner Gefolgschaft gehuldigt worden war.
Die Versammlung wurde eröffnet, das Bureau gewählt. Der Vorsitzende erteilte dem Referenten das Wort. Die ersten Sätze des Redners wurden in abwartender Haltung, mit stiller Aufmerksamkeit angehört, die weiteren Ausführungen aber erregten eine immer stärker werdende Bewegung. Stürmische Unterbrachungen, lebhafte Zurufe, tosende Bravo- und Beifallsrufe hinderten den Redner minutenlang am Reden.
»Wir alle wissen,« sagte er, »was wir unsrem Bebel zu danken haben, wir wissen, daß er immer in der vordersten Reihe der Kämpfer für Volksrecht und Volksfreiheit gestanden, wir wissen, daß ihn der Kampf gegen Unfreiheit, gegen Entrechtung und Unterdrückung des arbeitenden Volkes mehr als einmal ins Gefängnis gebracht hat, wir wissen endlich, daß es auch zum großen Teil seiner Unerschrockenheit, seiner immerwährenden Treue, seinem Fleiße und seiner Begabung zu verdanken ist, wenn wir uns heute stolz die Dreimillionen-Partei nennen können. Aber höher als die Person steht die Sache. Unsre Verehrung des großen Führers darf nicht in kritiklose, sklavische Anbetung ausarten. Für Personenkultus und Götzendienst ist in der Partei kein Raum. Niemals werden wir uns überzeugen lassen, daß blinder Autoritätsglauben und Kadavergehorsam unsre Pflicht sei. Selbst auf die Gefahr hin, aus der Partei zu fliegen, werden wir uns nicht den Mund verbinden, die Freiheit der Diskussion schmälern lassen. Wehe der Partei, in der es keinen Widerstreit der Ideen mehr gibt! Wir zetern über die eiserne Disziplin und den Kadavergehorsam beim Militär und sollten uns selbst eine ähnliche freiheitsfeindliche Diktatur errichten, die zum widerspruchslosen Gehorsam verpflichtet und die Kommandogewalt in die Hände der Führer legt? Nein! Wir sind eine demokratische Partei, eine sozialdemokratische, wir wollen denken und handeln nach unsern Anschauungen und Überzeugungen, nicht nach denen einiger weniger Führer. Sozialismus ist Erziehung zur Selbständigkeit, Wir sind weder Kinder noch Soldaten, die auf Befehl des Unteroffiziers einschwenken. Und so sind wir auch heute zusammengekommen, um Kritik zu üben an dem Verhalten unsrer Reichstagsabgeordneten, frei von der Leber weg wollen wir ihnen erklären, daß sie die Prinzipien der partei Preisgegeben, daß sie sozialdemokratische Logik und Konsequenz mit Füßen getreten, daß sie nicht in unsrem Sinne gehandelt haben, als sie für den Kriegskredit für die Marine stimmten und sich bei dem für die Landarmee geforderten Kredit der Abstimmung enthielten, anstatt laut, nachdrücklichst vor ganz Europa gegen den Krieg zu protestieren –.«
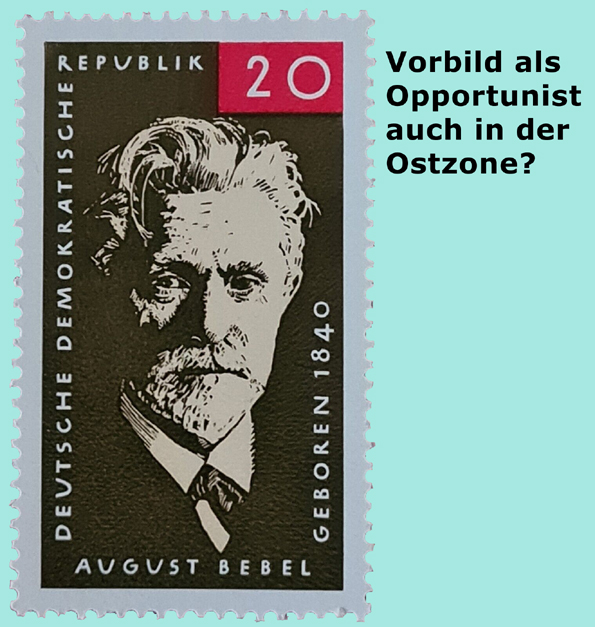 Laute Zurufe aus den Reihen der mit Bebel auf der Tribüne sitzenden Abgeordneten unterbrechen den Redner. Dieser lächelt sarkastisch, sein Gesicht den Bänken der Abgeordneten zukehrend.
Laute Zurufe aus den Reihen der mit Bebel auf der Tribüne sitzenden Abgeordneten unterbrechen den Redner. Dieser lächelt sarkastisch, sein Gesicht den Bänken der Abgeordneten zukehrend.
»Wir können uns nicht wehrlos machen, rufen Sie mir zu,« fährt er fort, »es handelt sich für uns um Notwehr, um einen Verteidigungskrieg. Und auf diesen alten Trick fallen Sie herein, Sie, die Sie doch alle erfahrene Politiker sind? Mit diesem allen Ammenmärchen wollen Sie Ihre schwächliche, inkonsequente, opportunistische Haltung entschuldigen? Mit dieser Formel, mit dieser Frase stellen Sie sich Ihren konservativen Kollegen im Reichstag an die Seite. Auch diese sind nicht so frivol und schamlos zu erklären: wir wollen den Krieg, wir wollen erobern und uns an dem Besitz der Gegner bereichern, auch diese begründen ihr Eintreten für den Militarismus immer damit, daß sie sagen, wir wollen den Krieg nicht, wir wollen nicht angreifen, aber wir müssen uns doch verteidigen, wenn wir vom Feinde angegriffen werden. Genau dasselbe sagen die Kriegsschwärmer jenseits der Grenzen. Auch diese erklären immer mit vielem Pathos und sittlicher Entrüstung: wir wünschen keinen Krieg und deshalb müssen wir gerüstet sein, um uns verteidigen zu können. Und selbst, wenn sie den Krieg beginnen und den ersten feindlichen Schritt unternehmen, sagen sie noch: wir konnten nicht anders, wir wurden gezwungen, wir wollten uns nur nicht überrumpeln lassen von den kriegslustigen Gegnern. Die beste Deckung ist der Hieb – (Stürmisches Gelächter)
Und so sehen wir denn das erbauliche Schauspiel, daß jeder den Frieden will und daß keiner das Karnickel gewesen sein will, das angefangen hat. Mit dieser kindischen Ausrede, mit dieser erbärmlichen Heuchelei soll man uns nicht kommen, wir lassen uns nicht dumm machen mit diesem Argument, dieser Mär vom Verteidigungskrieg. Die Vertretung der sozialdemokratischen Partei im Reichstag hätte die Pflicht gehabt, mit aller Entschiedenheit zu erklären: Im Namen des Volkes, des arbeitenden Volkes: Wir wollen keinen Krieg und nicht einen Pfennig bewilligen wir für den Krieg! (Stürmisches Bravo)
Daß Sie (zu den Abgeordneten gewandt) das nicht getan haben, war eine Schmach, war ein Verrat an der Sache des Volkes – (Stürmische Zustimmung.) Sie haben uns, die deutsche sozialdemokratische Partei vor Deutschland, vor ganz Europa blamiert, speziell aber vor unsern französischen Genossen. Haben Sie nicht gelesen, was Jaurès im französischen Parlament gesagt hat? Das klang wesentlich anders als das schwächliche opportunistische Gefasel Bebels im Reichstag. Die Scham hätte Ihnen ins Gesicht steigen müssen, als Ihnen der Reichskanzler mit sehr berechtigtem Hohn und Spott Ihre patriotischen Frasen vorhielt, die Sie und Ihr Gesinnungsgenosse Vollmar – Pardon: von Vollmar im Reichstag und sonst geäußert haben –. (Zwischenruf Bebels: »Haben wir nicht immer den Militäretat abgelehnt?«)
Jawohl, das haben Sie inkonsequenterweise –. (»Oho!«) Jawohl, wenn Sie konsequent sein wollte, Genosse Bebel, dann hätten Sie ebensogut wie Herr von Kardoff für den Militäretat stimmen müssen, denn Sie haben ja doch immer erklärt: ›Wenn es sich einmal darum handeln sollte, das Vaterland zu verteidigen, dann werden wir Sozialdemokraten nicht fehlen, dann werde ich selbst noch die Flinte auf meine alte Schulter nehmen.‹ Haben Sie damit nicht die Möglichkeit, die Berechtigung des Krieges anerkannt? Und wenn Sie diese taten, dann mußten Sie auch die Mittel zur Vorbereitung des Krieges, Ihres Verteidigungskrieges bewilligen, falls Sie den Mut der Konsequenz besaßen. (Brausendes Gelächter.)
Für einen Sozialdemokraten aber gibt es keinen Krieg, wir verdammen den Krieg in jeder Form, das Abschlachten von Menschen, die uns nichts zu leide getan haben, durch Flinte und Säbel. Es ist ein Verrat unsrer heiligsten Grundsätze und Anschauungen, den Krieg so gewissermaßen zu verherrlichen und als etwas Großes, als etwas Notwendiges und Pflichtmäßiges hinzustellen. Es ist eine Schmach, denen zu Hilfe zu kommen, die im servilen Dienste egoistischer Gewalthaber auf die Fantasie unsrer Jugend irreführend, verrohend, bestialisierend einwirken. – (Orkanartiger Beifallsausbruch; achttausend Menschen jubeln dem Redner zu. Minutenlange Unterbrechung, da die begeisterte Zustimmung sich immer wieder in stürmischen Beifallskundgebungen Luft macht.)
Sie, Genosse Bebel, und alle, die dem Krieg als etwas Unabänderliches, als eine ewige menschliche Institution anzusehen scheinen, berufen sich immer auf den Verteidigungskrieg. Bei den Herren von Zedlitz, von Oldenburg, Paasche und den andern hochkonservativen und nationalliberalen Herren verstehe ich, wie sie zu diesem Argument kommen. Aber bei Ihnen, Genosse Bebel, der Sie doch das Proletariat vertreten, verstehe ich das nicht. Ist Ihnen, Genosse Bebel, denn nicht bekannt, daß wir, daß das Proletariat überhaupt nichts zu verteidigen hat, aus dem einfachen Grunde, weil es nichts besitzt?
(Gelächter. Stürmische Zustimmung.)
Wozu sollen wir denn in den Verteidigungskrieg ziehen, wozu uns nach allen Regeln der modernen Menschenvertilgungskunst en masse aus der Welt befördern lassen? Wir, der überwiegend größte Teil des Volkes, ja fast das gesamte Volk, wir haben nichts zu verteidigen. 65 von hundert Steuerzahlern der preußischen Bevölkerung sind auf ein unversteuerbares Jahreseinkommen von höchstens 900 Mark eingeschätzt. Was haben diese 65 Prozent zu verteidigen, Herr Bebel? Ihnen, diesen zwei Dritteln des Volkes, kann der Ausgang eines Krieges ganz gleichgültig sein; von der Kriegsbeute bekommt das Volk bestimmt nichts ab. Unser Leben ist Arbeit und Not, Unterdrückung und Knechtschaft. Haben wir Proletarier, wir Enterbten des Glücks, Grund auf unser Vaterland stolz zu sein, uns zu echauffieren für das Bewußtsein, preußische Heloten zu sein, die nicht mitreden, nicht mitzuraten haben, die still zusehen müssen, wie ihnen das Fell über die Ohren gezogen wird? (Stürmisches, zorniges: »Nein, nein!«)
Jawohl, wir Proletarier, wir Besitzlosen können kein nationales Gefühl haben, unsre Ausbeuter, unsre Unterdrücker sind selbst schuld daran. Wie sagten doch unsre Großmeister Marx und Engels im kommunistischen Manifest? ›Die moderne industrielle Arbeit, die moderne Unterjochung unter das Kapital, dieselbe in England wie in Frankreich, in Amerika wie in Deutschland hat ihm – dem Proletarier – allen nationalen Charakter abgestreift.‹ Jawohl, so ist es, Genossen, wir haben kein nationales, wir haben internationales Gefühl. Mit den Zedlitz, den Heyl von Hernsheim, den Stinnes und Thyssen haben wir nichts gemein, mit denen fühlen wir uns nicht eins. Wir fühlen uns eins mit unsern proletarischen Brüdern, die wie wir in Unfreiheit und hartem Frondienst schmachten, wir fühlen uns eins mit den Armen und Unterdrückten in der ganzen Welt! (Begeisterte Zustimmung.)
Die 2,99 Prozent der Steuerzahler, hört wohl, Genossen, die noch nicht ganz 3 Prozent, die ein Jahreseinkommen von 3000 bis 6000 Mark versteuern, die haben wenigstens etwas zu verlieren, etwas zu verteidigen. Und die kleine Schar von 3⁄4 Prozent der Gesamtbevölkerung, die über 9500 Mark Jahreseinkommen bis in die Millionen hinein besitzen, die Großkapitalisten, die Feudalherren, die sich den Klassenstaat als Zwingburg ihrer bevorrechteten Klasse halten, diese 2/3 prozentige Macht mag für ihr Besitztum zittern. Diese 2/3 Prozent sind die Interessenten der Flinte und des Säbels, für die das Blut im Kriege wieder einmal den Erdball färben wird. Im Interesse dieser 2/3 Prozent der Bevölkerung wird uns der sogenannte Patriotismus als Tugend gepriesen und unsern Kindern in der Schule eingebläut.
Und wenn sich auch unter unsern Brüdern und Genossen noch eine große Anzahl solcher befinden, denen immer noch nicht die Augen aufgegangen sind, die noch immer nicht wissen, wessen Geschäfte sie eigentlich besorgen, wenn sie in den Krieg ziehen, wenn es immer noch viele, viele in der Partei gibt, die sich den Patriotismus suggerieren lassen, die mit Begeisterung die Mordmaschinen bedienen und die wirklich glauben, einer heiligen Pflicht zu genügen, die sich als Helden dünken, so ist das Ihre Schuld mit, Genosse Bebel, Ihre und Ihrer Gesinnungsgenossen in der Partei und aller derer, die Ihnen zujubeln. Jawohl, Sie sind es, Genosse Bebel, der sich immer allen Bestrebungen in der Partei, die darauf hinzielten, eine zielbewußte, energische, antimilitaristische Propaganda zu machen, entgegenstellte. Sind sie nicht dem Genossen Karl Liebknecht, als er in Bremen und darauf wieder in Mannheim einen Antrag in dieser Richtung stellte, über den Mund gefahren wie einem dummen Jungen? Haben Sie sich nicht mit dem Gewicht Ihrer ganzen Persönlichkeit, Ihres Ansehens in der Partei gegen Antrag 114 des Wahlvereins Potsdam-Osthavelland gestemmt, der bezweckte, einen ständigen Ausschuß einzusetzen mit dem besonderen Auftrage, gegen den Militarismus, dieses stärkste Bollwerk des Kapitalismus, der unser Volk brutalisiert und barbarisiert, in jeder zulässigen Weise zu agitieren? Haben Sie nicht dagegen mit allem Aufgebot sittlicher Entrüstung gedonnert, als wäre die Partei in Gefahr? Unter den Gründen, mit denen Sie damals Ihren schroffen, erbitterten Widerstand gegen diesen Antrag bemäntelten, der die Aufklärung der Menge in einer der wichtigsten, nein, der wichtigsten Frage des öffentlichen Lebens überhaupt bezweckte, befand sich unter anderem dieses Argument: Ein besonderer Kampf gegen den Militarismus ist überflüssig. Auch mit unsern bisherigen Agitationen erreichen wir das, was erreicht werden muß. ›Allmählich, auf dem Wege der natürlichen Entwicklung‹, so sagten Sie einmal ungefähr, ›wachsen wir in den sozialen Staat hinein und dann gibt es keinen Militarismus mehr.‹
O, Genosse Bebel, sind Sie so kindlich anzunehmen, daß der Kapitalismus ruhig zusehen wird, wie wir in den sozialen Staat hineinwachsen? Und wie sollten wir den Kapitalismus überwinden und besiegen, solange er sich auf den Militarismus stützen kann? Nein, Genosse Bebel, solange wir nach Ihrem Wunsch den Militarismus ängstlich als ein Pflanze ›Rühr‘ mich nicht an‹ betrachten und behandeln, solange diese schneidige Waffe dem Kapitalismus zur Verfügung steht, solange ist auch dieser unbesieglich. Daß Sie das nicht erkannt hatten, Genosse Bebel, daß die Agitation gegen den Militarismus die brennendste Notwendigkeit für den endlichen Sieg des Sozialismus ist, unsre erste, höchste Aufgabe, das wiegt alle Ihre Verdienste um den Sozialismus auf. Soll ich Ihnen die Riesenentwicklung des Militarismus mit Zahlen beweisen? Sie kennen sie so gut, wie wir alle. Wohin soll es führen, wenn der Militarismus ungehindert fortfährt, die Produkte zu überwuchern und zu verdrängen, wenn alles, was der Fleiß des Volkes erwirbt, dazu dienen muß, den Militärmoloch zu füttern, wenn dem zerstörten Markte die zerstörte Justiz, das niedergetretene Recht als Begleiterscheinung der im Militarismus erdrückten Kultur folgen? Der Militarismus bringt schließlich alle Hände zur Strecke, er verschlingt zuletzt die letzte Frucht der Produktion, bis die Leiber der ausgemergelten, geknechteten, getretenen Proletarier das Massengrab unsrer zeitigen Kultur füllen. Mit Ihrer ängstlichen, opportunistischen Taktik, Genosse Bebel, wachsen wir nicht in die erstrebte Kultur hinein, wir sinken immer tiefer in das Völkergrab, das der Militarismus der Menschheit gräbt. Die Produktion, Recht und Kultur können nur im Rechtsstaatgedeihen. Ein bewaffneter Rechtsstaat ist ein Unding, eine Utopie; es hat in historischer Zeit noch nie einen Militärstaat gegeben, der zugleich Rechtsstaat war. Deshalb muß jeder, der den Rechtsstaat vertritt, zu allererst den Militarismus beseitigen. …..
Nun sehen Sie ja, Genosse Bebel, die Folge Ihrer Taktik, Ihrer zarten Rücksichtnahme auf die Gefühle unserer politischen Gegner, Ihrer ängstlichen Scheu, dem Militarismus zuleibe zu gehen, nun haben wir den Krieg. Sie, Genosse Bebel, Sie und alle, die sich in blindem Götzendienst Ihrer Autorität gefügt haben, sind Mitschuldige an diesem Kriege, an dem ungeheuren Blutvergießen, an dem namenlosen Elend und Jammer, an Verwüstung und Greuel allerart, die die Welt bald sehen wird, Sie sind mitschuldig an dem Tod der Hunderttausende, die bald in der gräßlichen Waffenschlächterei, die man Krieg nennt, zugrunde gehen werden.«
Starke anhaltende Bewegung. Bebel und die anderen anwesenden Abgeordneten springen entrüstet auf und protestieren durch Gebärden und Rufe, die in dem ungeheuren Tumulte niemand hört. Viele der Arbeiter unten im Saal stürzen in wildester Erregung gegen die Tribüne vor mit heftigen, wütenden Gebärden gegen die auf der Tribüne stehenden Abgeordneten. Der anwesende Polizeileutnant greift nach seinem Helm. Der Vorsitzende schwingt aus Leibeskräften die Klingel und macht durch eine bezeichnete Geste die Versammlung auf die Gebärde des Polizeibeamten, der mit der Auflösung der Versammlung droht, aufmerksam. Die Aufregung legt sich rasch und der Redner fährt fort.
»Jedenfalls, Genosse Bebel, haben Sie und Ihre Fraktionskollegen sich einer groben Pflichtversäumnis schuldig gemacht, ja, Sie haben Ihre Pflicht als Vertreter der Partei, als Vertreter des überwiegend größten Teiles des deutschen Volkes mit Füßen getreten. Wir haben von Ihnen nicht erwartet, daß Sie offnen Widerstand gegen Staatsgesetze proklamieren. Wir halten niemand ab, seiner gesetzlichen Dienstpflicht zu folgen. Aber, was Sie hätten tun können, ja, tun müssen, das wäre gewesen, der Regierung zu erklären, daß wir, daß unsere Genossen nur gezwungen in den Krieg gehen, nicht aus eigenem Verlangen, aus eigenem Empfinden, sondern nur weil sie müssen, weil sie nicht anders können. Mit aller Kraft und Entschiedenheit hätten Sie gegen den Krieg protestieren, hätten Sie die verlangten Mittel zur Kriegsführung ablehnen müssen, anstatt sich inkonsequent, in nichtsnutzigem Opportunismus der Abstimmung zu entziehen. Sie hätten der Regierung sagen müssen: Gut, wir gehen in den Krieg, wenn es sein muß, aber unlustig, widerwillig gehen wir. Das Volk verabscheut den Krieg, das Volk will keinen Krieg mehr. Und die Regierung, die sehr wohl weiß, daß sichmit einem Heer, das nicht mit Begeisterung, aus innerster Überzeugung in den Krieg zieht, keine siegreichen Schlachten schlagen lassen, wäre vielelicht wankend geworden und wäre im letzten Augenblick doch noch vielleicht vor dem Kriege zurückgeschreckt. Sie aber haben nicht nur gegen uns, das Volk, pflichtvergessen gehandelt, Sie haben auch die Regierung getäuscht, Sie haben sie getäuscht durch Ihr Verhalten, durch Ihre lahmen, lauen Erklärungen, Sie haben sie nicht aufgeklärt über die wahren Empfindungen des Volkes, Sie haben der Regierung nicht gezeigt wie tief in unseren Seelen der Abscheu vor dem Kriege ist, davon haben Sie die Regierung nicht überzeugt, weder im Reichstage, noch durch Ihr Verhalten auf den Parteitagen in Bremen und in Mannheim. Das ist Ihre Schuld, die Sie nicht mehr sühnen können, nie – nie! (Tosender, langanhaltender Beifall, der die Proteste der anwesenden Abgeordneten immer wieder erstickt.)
Und nun zuletzt muß ich Ihnen, Genosse Bebel, auch noch den Vorwurf machen, daß Sie sich gegen die Parteidisziplin, die Sie doch gegen Andersdenkende immer so streng gewahrt wissen wollen, schwer vergangen haben. Auf dem internationalen Sozialistenkongreß zu Paris im Jahre 1900 ist von den Legaten einstimmig, die deutschen Vertreter eingeschlossen, erklärt worden: 1. daß es nötig ist, daß die Arbeiterpartei in jedem Lande mit verdoppelter Macht und Energie gegen Militarismus und Kolonialpolitik auftrete; 2. daß es vor allem unbedingt notwendig ist, die weltpolitische Alliance der Bourgeoisie und Regierungen zur Verewigung des Krieges durch eine Alliance der Proletarier aller Länder zur Verewigung des Friedens zu beantworte. – Sie, Genosse Bebel, haben sich immer gegen die Ausführungen dieser Erklärungen gestemmt, indem Sie wiederholt behaupteten, daß in der Frage des Militarismus nicht in Übereinstimmung mit dem Proletariat andrer Nationen vorgegangen werden könne, daß sie vielmehr national in jedem Lande für sich gelöst werden müsse.
Der internationale Kongreß in Paris 1900 hat ferner einstimmig beschlossen: 1. daß die sozialistischen Parteien überall die Erziehung und Organisierung der Jugend zum Zweck der Bekämpfung des Militarismus in Angriff zu nehmen und mit größtem Eifer zu betreiben haben. Wie leidenschaftlich, ja, wie mit förmlich wütendem Eifer Sie, Genosse Bebel, jeden Versuch bekämpft haben, den Beschluß des internationalen sozialistischen Kongresses von 1900 in Deutschland zur Ausführung zu bringen, das habe ich schon vorhin dargelegt. Im Gegenteil, Sie, Genosse Bebel, Sie schwärmen ja für die allgemeine Volksbewaffnung, für eine Volkswehr und wollen, daß schon die Jugend in den Schulen militärisch gedrillt wird. (Brausendes Gelächter. Zuruf: »Das fehlte uns gerade noch!«)
Auf dem internationalen Kongreß in Paris wurde ferner beschlossen, daß die sozialistischen Vertreter in allen Parlamenten unbedingt gegen jede Ausgabe des Militarismus, Marinismus oder de Kolonialexpeditionen zu stimmen verpflichtet sind. Auch gegen diesen Beschluß haben Sie, Genosse Bebel, und Ihre Fraktionskollegen wiederholt, bei den Herero-Krediten und jetzt wieder, gehandelt. Und wegen dieser doppelten, schweren Verfehlung, in erster Linie wegen des schmachvollen, unentschuldbaren Versagens im Kampfe gegen den Militarismus beantrage ich, daß wir dem Genossen Bebel und den andern Mitgliedern unsrer Reichstagsfraktion unsre schärfste Mißbilligung aussprechen, daß wir ihnen ein Mißtrauensvotum erteilen.«
Ein ungeheurer Tumult entstand. Bebel sprang voll Entrüstung und Zorn auf. Noch nie, solange er in der Partei war, hatte man gewagt, ihm in dieser Wiese gegenüberzutreten, durch lange Jahre hindurch hatte er sich gewöhnt, sich gewissermaßen als Diktator der Partei zu fühlen, jedenfalls hatte er wieder und wieder den Beweis erhalten, daß ihn das Gros der Genossen geradezu vergötterte, daß er sicher sein konnte, bejubelt zu werden, sobald er nur den Mund auftat. Ja, er hatte wiederholt erlebt, daß, wenn auch gelegentlich einem seiner Widersacher unter den jüngeren radikaleren Elementen oder auch aus revisionistischen Kreisen von der Versammlung Beifall gespendet wurde, er nur persönlich aufzutreten brauchte, um allen Widerspruch zum Schweigen zu bringen. Noch immer war jeder Angriff gegen ihn aus Parteikreisen von ihm abgeschlagen worden, noch immer hatte zuletzt die Majorität der Genossen ihm zugejubelt und sich seiner Ansicht, seiner Autorität gefügt. Und so würde es auch diesmal sein. Wenn er nur erst zum Sprechen kam, er würde die Törichten, Irregeleiteten, Wankelmütigen durch die Macht seiner Rede, durch den nie versagenden Zauber seiner Persönlichkeit zu sich zurückzwingen.
Er winkte dem Vorsitzenden, daß er reden wollte. Der Genosse schwang auch aus Leibeskräften die Klingel, aber in dem Lärm der wild durcheinanderschreienden Genossen war es unmöglich, sich Gehör zu verschaffen.
Da trat der greise Volkstribun, der schon so manche wilde Aufregung durch seine bloße Erscheinung beschworen hatte, ganz dicht an die Rampe der Tribüne, beugte sich vor und blickte scharf, tadelnd zur Menge hinab und winkte mit beiden Armen, ihm das Wort zu erteilen.
Aber wunder, diesmal wirkte seine Popularität nicht, der Zauber schien gebrochen; die tobende Menge wollte seine Autorität, das gottähnliche Ansehen, das er immer genossen, nicht mehr anerkennen. Die Erbitterung, die sich im Laufe der Jahre doch bei vielen radikalen Elementen über seine schroffe Ablehnung der antimilitaristischen Anträge angesammelt hatte, der Unwille über die Abgötterei, die mit dem Führer in der Partei getrieben worden war, der ärger über den Autoritätsdünkel, den er manchmal in verletzender Weise hervorgekehrt hatte, brach mit elementarer Gewalt durch. Das Johlen und Schreien nahm kein Ende.
Da machte der überraschte, bitter enttäuschte greise Volkstribun eine heftige, zornige, verachtungsvolle Gebärde gegen die zu ihm Hinaufschreienden. Der Sturm der Entrüstung, zu der die scharfen Angriffe des Referenten die versammlung angestachelt hatten, wuchs zum Orkan. »Nieder mit Bebel! Volksverräter! Feigling!« und andere wilde Schreie flammender Empörung drangen zu dem entthronten Diktator hinauf.
Und mit wütender Gebärde drang man gegen die Tribüne, gegen den erbleicht Zurückwankenden vor.
Da griff der Polizeileutnant nach seinem Helm und stülpte ihn auf sein Haupt.
»Die Versammlung ist aufgelöst!« schnarrte er in dem üblichen Kommandoton. […]
[soweit der faszinierende Roman bis hierher auf Seite 104; er endet dann auf Seite 275]
13.05.2024 [Abbildungen: koka-augsburg: Archiv]
Feedback: info@koka-augsburg.com
bedürfnisse
Das Elend der Bedürfnisse im Kapitalismus
Im Kapitalismus werden permanent neue Bedürfnisse geschaffen. Und zwar sowohl hinsichtlich der Verwertung des Kapitals und der dafür notwendigen politischen Entscheidungen wie hinsichtlich der Reproduktion seiner Grundlagen. Ob diese Bedürfnisse illusionär sind oder nicht, ist erst einmal nicht die Frage, das entscheidet sich ja sowieso in der Praxis ihrer Bedienung und der Möglichkeit ihrer Bedienung.
Marx hat im ersten Kapitel des ersten Abschnitts des Kapitals darauf hingewiesen, daß die Bedürfnisse die Zwecke menschlichen Handelns erschließen.
An dieser Stelle soll sich nun nicht mit den Bedürfnissen des Kapitals — sowohl des produktiven Kapitals, des Handelskapitals wie des Geldkapitals — befaßt werden, mit seinem unermeßlichen Bedürfnis nach immer neuem Kredit und (Re-)Finanzierung seines Geschäftsgangs. Dies ist bei Marx ausführlich zu studieren. Ebenso wenig soll an dieser Stelle auf das Bedürfnis der politischen Gewalt, des Staates an einer für ihn nützlichen Wirtschaft(sordnung) eingegangen werden.
Wenden wir uns den Bedürfnissen der »einfachen Leute« zu, also derjenigen, die ihre Arbeitskraft zu Markte tragen müssen, um ihre (Lebens-)Bedürfnisse befriedigen zu können. Diese scheinen ja gerade unter kapitalistischen Umständen vielfältiger zu sein denn je.
Eine weit verbreitete Meinung ist die, daß es Bedürfnisse gibt, die in Ordnung gehen und welche, die nicht in Ordnung gehen. Diese moralische Sortierung der Bedürfnisse leugnet ihre — systemimmanente — Notwendigkeit. Inwiefern? Die Abschaffung des Kapitalismus würde zweifellos vom penetrant permanenten Druck befreien, Entscheidungen bezüglich der Erfüllung seiner Bedürfnisse zu fällen. Bedürfnisse, die zum guten Teil unmittelbar dem System geschuldet sind und zum anderen unter es subsumiert sind, insofern sie einem Umgang mit und einem Zurechtkommen in ihm geschuldet sind und sich ganz praktisch in dem Verfügen über allzu wenig Zeit und Geld geltend machen.
An diesem Punkt sind Bedürfnisse in zweierlei Hinsicht festzuhalten: In die unmittelbar der Reproduktion geschuldeten und in die einer — dem Individuum als solche oftmals kaum bewußte — Entschädigungserwartung, welche, solange das System andauert bzw. solange man ihm nicht auskommt, gleichzeitig zu Tage treten, die aber auseinanderfallen, sobald das nicht mehr der Fall ist. Gebunden sind die Bedürfnisse allenthalben an ein Bewußtsein eines der kapitalistischen Gesellschaftsordnung verhafteten Individuums, der Art, daß es sich immer um sich dreht (und drehen muß) und daher — dieser Schluß ist kein notwendiger! — der Meinung ist, die Welt drehe sich um das eigene Ich. Dabei pfeift die Welt auf das Individuum: Was man zumal daran sieht, daß jeder Euro »Anpassung« der Renten oder des Arbeitslosengeldes an das Existenzminimum als »Erhöhung« verstanden wird und so schwerste Bedenken ob seiner nationalen Verantwortung hervorruft. Doch sobald das wahrgenommen wird, wird sich das Individuum nicht mehr in dieser Weise wichtig empfinden. Solche Wahrnehmung ist dem Individuum in aller Regel fremd, das einmal etablierte Bewußtsein des Individuums empfindet eigene Unwichtigkeit — die sich oft genug nicht verleugnen läßt — als Defizit und kämpft mit allen Mitteln dagegen an. Es kämpft also in aller Regel eben nicht gegen die Ursache seiner Lage, der gegenüber weiterhin Ignoranz herrscht, und, insofern nicht Ignoranz herrscht, ihr gar die Bescheinigung ausgestellt wird, die Sache von Geschäft & politischer Gewalt ginge schon in Ordnung. Das Individuum kümmert sich also vornehmlich um seinen Status und die Symbole, die es dafür braucht, als gesellschaftlich anerkannt zu gelten. Deshalb ist Angeberei das allerselbstverständlichste: In seiner Rede stellt das Individuum permanent sich heraus — im ausgesprochenen und unausgesprochenen Vergleich mit anderen und der Welt.
Dafür gibt es wirklich keine Notwendigkeit, aber das Individuum macht es trotzdem, es hat in all seiner Freiheit einfach ein Bedürfnis danach, ein Bedürfnis nach Anerkennung [— ein Gipfel scheint mit facebook im Moment einmal mehr erreicht]. Dies unterstellt, daß das Individuum in der kapitalistischen Gesellschaft dieser nichts wert ist. Diese schafft ihre Opfer, ja geht, wie ja sogar der römisch-katholische Papst bemerkt
hat, kaltlächelnd über jede Menge Leichen. Die freilich sind das notwendige Produkt kapitalistischer Verhältnisse. Daß wegen dem blödsinnigen Bezug der Individuen auf das kapitalistische System, durch ihren Konkurrenzkampf um Anerkennung, noch mehr unschöne Zurichtungen, ja Leichen anfallen — nämlich die aus den zwischenmenschlichen Beziehungen — als ohnehin, soll damit natürlich keineswegs entschuldigt werden. Die sind quasi eine »Extraakkumulation« des Kapitalismus auf Seiten seiner Opfer.
 So wie die kapitalistische Gesellschaft stets Bedürfnisse über die unmittelbarsten Lebensbedürfnisse hinaus hervorbringt, so grundverkehrt wäre es deshalb jedenfalls, den Kapitalismus abzuschaffen, das in seiner Bürgerlichkeit befangene Bewußtsein aber unangetastet zu lassen — so wie sich das Altlinke vorstellen, welche dem existenten falschen Bewußtsein des Proletariats ein (moralisches) Gütesiegel ausstellen —. Denn die Entschädigungshaltung jenes (untertänigen) Bewußtseins wirkt ebenso nach, wie überhaupt die Einstellung, daß sich die Welt um das eigene Ich drehe beziehungsweise zu drehen habe.
So wie die kapitalistische Gesellschaft stets Bedürfnisse über die unmittelbarsten Lebensbedürfnisse hinaus hervorbringt, so grundverkehrt wäre es deshalb jedenfalls, den Kapitalismus abzuschaffen, das in seiner Bürgerlichkeit befangene Bewußtsein aber unangetastet zu lassen — so wie sich das Altlinke vorstellen, welche dem existenten falschen Bewußtsein des Proletariats ein (moralisches) Gütesiegel ausstellen —. Denn die Entschädigungshaltung jenes (untertänigen) Bewußtseins wirkt ebenso nach, wie überhaupt die Einstellung, daß sich die Welt um das eigene Ich drehe beziehungsweise zu drehen habe.
Die unmittelbaren Bedürfnisse, die für die Reproduktion unentbehrlichen Bedürfnisse, werden unter kapitalistischen Verhältnissen folgendermaßen definiert: Für Arbeiter, die keine Arbeit finden werden sie stofflich festgehalten und danach — wie in der BRD — die Arbeitslosengelder bemessen; je länger einer arbeitslos, desto wertloser wird er, mit desto weniger wird er gezwungen, auskommen.
Für niedrige Beschäftigungen gibt es Mindestlöhne, welche die Tarifpartner vereinbaren. Diese Löhne gibt oftmals der Staat als Untergrenze vor und daran haben sich die Tarifparteien zu orientieren. So keine solchen Festsetzungen gibt, gilt das Gebot des Staates, das »unsittliche« Löhne unterbindet. — Nur im Falle solch unsittlicher Löhne ist in der kapitalistischen Gesellschaft von »Ausbeutung« die Rede. Ausbeutung also als moralischer Begriff und nicht als sachlicher, einer Bezahlung der Arbeitkraft unter ihrem Wert, wie bei Marx. — Diese Schicht von Arbeitern hat also für ihre Reproduktion mehr zur Verfügung als unmittelbar nötig zu sein scheint. Schließlich wird hier nicht bloß ein Malocher entlohnt, sondern ein (steuerzahlender) Staatsbürger belohnt.
Natürlich obliegen Ent- und Belohnung nicht den Interpretationen der Lohnabhängigen selber. Ihr Daseinszweck kann ja auch unmöglich mit dem übereinstimmen, für den sie vorgesehen sind. Dennoch interpretieren sie dauernd an ihrem Lohn herum und kommen damit nie weiter, als sich mit ihrem »Schicksal« abzufinden*. Daß dafür einige interpretatorische Kunststücke vonnöten sind, liegt auf der Hand. Alles, was mit Angeberei zu tun hat, beruht darauf und knüpft an dem bereits erwähnten Bedürfnis nach Anerkennung an.
Die Befriedigung der Bedürfnisse ist nie sichergestellt, geschweige denn je gesättigt. Wie sollte sie auch! Schließlich schafft der Kapitalismus zu den bestehenden immerzu neue Bedürfnisse, knüpft ihre Befriedigung an einen zu entrichtenden Preis und schließt so ihre Befriedigung mangels Zahlungsfähigkeit weitgehend aus. Und dennoch gibt es eine Sehnsucht eben danach, also ein Bedürfnis hinwiederum, welches diese ewige Jagd nach einem andauernden Zustand der Befriedigung beendet. Dieses Bedürfnis freilich wendet sich nur selten und ausnahmsweise der Realität so zu, wie es diese erfordern würde, um dem Problem endlich einmal Herr zu werden.
Viel eher betätigt sich dieses Bedürfnis übersetzt in das Bedürfnis eines Staatsbürgers. Der Staat selber wäre ihm die Erfüllung dieses Bedürfnisses schuldig. Zum Beispiel in dem er Arbeitsplätze schafft bzw. die Bedingungen für das Kapital so verbessert, daß es Arbeitsplätze schaffen kann — ganz so, als ob das sein Existenzzweck wäre. Dafür, daß er, der Vater Staat, die Arbeit an den Arbeitsplätzen dann für die
Lohnarbeiter per Gesetz erträglich und dauerhaft macht und so das Kapital dazu verpflichtet. Daß, wenn der verehrte Staat schon den »Arbeitgebern« hinsichtlich einer flexiblen Aus- und Abschöpfung der Arbeitskräfte Freiheiten einräumt, er auch ihnen, den Lohnarbeitern, die Möglichkeiten eröffnet, ihre Reproduktionsnöte und die ihrer Familie von der Kindertagesstätte bis zu den Ladenöffnungszeiten angemessen bewältigen können.
Der Abschuß allerdings ist es, wenn jemand, der zum Prekariat (der moderne Ausdruck für Subproletariat) gehört, also jemand, der hinten und vorne seine Bedürfnisse nicht befriedigen kann, weil er der Mittel dazu entbehrt, wenn so jemand anderen Bescheidenheit und Verzicht predigt. Wenn so jemand seine Ansprüche auf einen letzten Aufschrei an den Staat reduziert, er, der Staat möge ihn in seiner Notlage wenigstens in Ruhe lassen, in Ruhe leben lassen, als ob das ein Leben wäre!
Zu solchen Typen gehören die Vertreter eines bedingungslosen Grundeinkommens (nicht jedoch ein Götz Werner, der als Unternehmer dies aus ganz anderen Gründen propagiert — er hängt ja dem Bedürfnis nach, Lohnkosten einsparen). Sie geben mit dem Ruf nach ihm kund, daß sie, so mies ihre Existenz auch ist, sie unbedingt mit dem kapitalistischen System in Frieden auskommen wollen. Und dabei, so widerlich opportunistisch ist ihr Antrag, wollen sie sich mit dem Staat nicht im geringsten anlegen: Denn daß sie Kapitalismuskritiker werden wollen, dazu wollen sie sich ja gerade nicht bequemen. Ganz im Gegenteil, sie wollen ja gerade denjenigen, welche sich zu einer Gegnerschaft gegen ein System unwirtlicher Verhältnisse entschlossen haben, beweisen, daß es völlig überflüssig und deplatziert ist, Gegner des Kapitalismus zu werden: Beweis: Man könne ja mit ihm auskommen, wenn man seine Bedürfnisse auf das unmittelbar Notwendige bescheide & beschränke. Soviel gesunden Opportunismus, so ihre Berechnung müsse der Staat einfach honorieren!
Die Qualität einer Ware zeigt sich in ihrem Gebrauchswert (vgl. Marx, Das Kapital, erster Abschnitt, erstes Kapitel). Bezogen auf die Ware Arbeitskraft heißt das, ihr Gebrauchswert besteht in ihrer Verwertbarkeit.
Diese Vernutzbarkeit lebendiger Materie (sie ist im Gegensatz zu allen anderen Waren nicht im Besitz eines Kapitaleigners, also frei und aller Selbstbestimmung zum Trotz fast uneingeschränkt frei verfügbar) diese Ausbeutbarkeit wird an ihr durch Schule und Erziehung — also das, was die kapitalistische Gesellschaft unter »Bildung« versteht — hergestellt. Und nicht nur das: Das Individuum muß sich um die Herstellung seiner Verwertbarkeit selber kümmern. Was anfangs in der Schule noch einen äußeren (staatlich eingerichteten) Zwangsrahmen (Schulpflicht) hat, das obliegt später im Berufsleben (einschließlich den Zeiten von Arbeitslosigkeit) dem Individuum unter dem stummen Zwang der kapitalistischen Verhältnisse weitgehend selber. Eine Anstalt für (Lohn-)Arbeit sorgt da dann schon für den gehörigen (Nach-)Druck.Diese Vernutzbarkeit trägt das Individuum zu Markte und muß sie zwecks eigener Reproduktion, die an die Verfügung über Geld gebunden ist, zu Markte tragen. Ob die Arbeitskraft dann wirklich einer Verwertung anheimfällt, ob sie tatsächlich gebraucht wird, das ist damit noch nicht gesagt. Und es ist noch nicht einmal gesagt, daß ein höherer Grad an hergestellter Verwertbarkeit gebraucht wird, da nutzt all guter Wille der zu Markte getragenen Verwertbarkeit mittels Ausbildungszeugnissen nichts. Das Nicht-Gebrauchwerden der Arbeitskraft an sich hielten die ja lässig aus, wenn gleichzeitig ihre Reproduktion umfassend und zwanglos gewährleistet wäre. Ist sie aber nicht, weil der Staat den Druck auf die Herstellung von Verwertung aufrecht erhalten will. Er legt es nämlich dem Individuum zur Last, wenn es nicht in einem Arbeitsprozeß ge- und verbraucht wird. Diese Unverfrorenheit sei den hochmoralischen Befürwortern eines Grundeinkommens ins Gehirn geschrieben, damit sie wissen, an wen sie ihre Bitte richten. Kann man denn vom kapitalistischen Staat solch uneigennützige Hilfe erwarten?
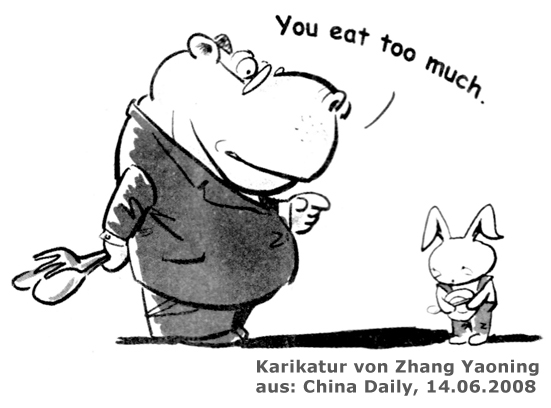 Und wahrscheinlich, weil in der kapitalistischen Gesellschaft kein Blödsinn zirkuliert, der nicht noch übertroffen werden kann und muß und soll, gibt es Leute, die das Verhältnis — das, wer was verwertet — auf den Kopf stellen: Sie behaupten allen Ernstes, nicht sie werden vernutzt als Lohnabhängige, die sie sind; nein, sie selber wären die Schweine, welche die — ansonsten allenthalben genießbare kapitalistische — Gesellschaft verheizen! Ihnen ist es wichtig, daß die Gesellschaft an ihrem eigenen Verhalten gesundet: Also essen sie kein Fleisch. Und gehen damit auf Mission!
Und wahrscheinlich, weil in der kapitalistischen Gesellschaft kein Blödsinn zirkuliert, der nicht noch übertroffen werden kann und muß und soll, gibt es Leute, die das Verhältnis — das, wer was verwertet — auf den Kopf stellen: Sie behaupten allen Ernstes, nicht sie werden vernutzt als Lohnabhängige, die sie sind; nein, sie selber wären die Schweine, welche die — ansonsten allenthalben genießbare kapitalistische — Gesellschaft verheizen! Ihnen ist es wichtig, daß die Gesellschaft an ihrem eigenen Verhalten gesundet: Also essen sie kein Fleisch. Und gehen damit auf Mission!
Solche Idioten braucht der Kapitalismus nicht wirklich, sie sind, wenn es sie denn schon gibt, jedoch nicht schädlich. Mit deren Quatsch versuchen übrigens die Protagonisten des Kapitalismus Opposition überhaupt zu diskreditieren, indem sie ihn adaptieren (»Veggie-Day« und dergleichen).
Kurzum, während die Bedürfnisse des Staates und seiner Wirtschaft auf ihre Kosten kommen, bleiben die Bedürfnisse derer, die ihre Arbeitskraft zwecks Gelderwerb verausgaben müssen, eine Dispositionsmasse der anderen Seite.
05.05.2024
Feedback: info@koka-augsburg.com
__________________________
* zum »subjektiven Faktor« und zur proletarischen Moral siehe ausführlicher: P. Decker/K. Hecker: Das Proletariat, 2002, S. 253ff
Kampf gegen Umweltzerstörung
Wie bekämpft man das Umweltdesaster?
„Manche sagen, ich solle lieber in die Schule gehen. Manche sagen, ich solle lernen und Klimaforscherin werden, damit ich »die Klimakrise lösen« kann. Aber die Klimakrise ist bereits gelöst. Alles, was wir tun müssen, ist, aufzuwachen und etwas zu ändern.“ (Greta Thunberg, 31.10.2018 in London)
Marx war zwar nicht der erste*, der die Natur unter gesellschaftwissenschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet hat, allenfalls der erste für das Zeitalter des Kapitalismus. Wie selbstverständlich hat er die natürliche Umgebung des Menschen und ihn selber dargestellt als von ihm selber gestaltet: Er, der Mensch, also nicht Spielball der Naturgewalten ist, sondern deren Beherrscher. Und es ist klar, daß heute bzw. eben auch schon zu Marx‘ Zeiten längst nicht der Mensch als solcher Beherrscher der Natur ist, sondern er selber ein Spielball, nämlich der von ihm ins Leben gerufenen »Sachzwänge«. Am Anfang der Entwicklung kapitalistischer Gesellschaften war es noch so wie Marx als Notwendigkeit eben solcher feststellt: »Nicht das tropische Klima mit seiner überwuchernden Vegetation, sondern die gemäßigte Zone ist das Mutterland des Kapitals.«**
Und Marx hat in seiner Analyse des Kapitals eine weitere Notwendigkeit des Interesses an Verwertung von Kapital herausgefunden: »Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.«*** Die Sorge bezüglich der Untergrabung der Natur einschließlich des Klimas hat als solche etwas Ideologisches an sich, dann nämlich, wenn sie nicht auf die kapitalistische Produktionsweise zurückgeführt wird. Wenn es heißt »der Mensch — das Schwein«, der Mensch, der so rein biologisch ja gar nicht tätig ist. Er betätigt sich allenthalben als Charaktermaske (Marx) gesellschaftlich etablierter und institutionalisierter Interessen. Der Mensch ist eben Staatsmann (Politiker), Kapitalist, Lohnarbeiter oder in anderer Form Funktionsträger der Gesellschaft. Als solche dürfen und sollen »die Menschen« sich betätigen, ihre Dienste (am Sachzwang, versteht sich!) einbringen. Gegen den gesellschaftlich sachzwanghaften Zusammenhang — der einer der monopolisierten Gewalt, eben eines Staates, ist, — Einspruch zu erheben, ist weder vorgesehen noch erwünscht noch gar zugelassen.
Klimasorgen zu ventilieren muß, soll und kann kein Einspruch gegen die herrschenden Verhältnisse sein, sondern umgekehrt, Sorgen eben dieser Verhältnisse zur Aufrechterhaltung ihrer selbst ernst zu nehmen: Als ob es sich nicht von selber verstünde, daß die Verhinderung der Zerstörung nicht den Verursacher retten kann. Oder anders ausgedrückt: Wem es um die Rettung des Kapitalismus geht, der nimmt die Zerstörung unweigerlich in Kauf. Die Zerstörung der Natur ist dann nichts anderes als eine geheuchelte Sorge. Diese Sorge paßt zu den maßgebenden Charaktermasken kapitalistischer Dogmata allen voran dem der Freiheit des Kapitals. An Zynismus ist diese Heuchelei nicht zu überbieten. Ja, es ist wirklich geradezu unangenehm, feststellen zu müssen, daß Kritiker der Klimaveränderung und der sonstigen Umweltzerstörung so naiv sind, daß sie sich an solche dem kapitalistischen Zwang verpflichteten Figuren wenden und mitunter von jenen gar einladen lassen. Und man merkt, wie sie sich so gar nicht wohlfühlen, gar nicht wohlfühlen können in deren unheimlichen Gesellschaft, in dieser Gesellschaft von scheißfreundlich sich gebenden Funktionärstypen.
Und es ist nicht so, daß das kapitalistische Empire nicht »Mißvertändnisse« zu kreieren weiß, 1. Beispiel:
Unverdrossen wird daran festgehalten, daß das kapitalistische Management, die Resultate ihrer Wirtschaft in den Griff bekommen kann: So lobt Jason Clay vom World Wildlife Fund for Nature einen Konzern: »Mars hat sich in Sachen Nachhaltigkeit verpflichtet, im Bereich Meeresfrüchte nur zertifizierte Produkte zu kaufen. Erstaunlicherweise kauft Mars mehr Meeresfrüchte als Walmart, weil sie Tiernahrung herstellen. Und sie machen wirklich interessante Sachen im Bereich Schokolade. Und all das kommt daher, daß Mars auch in Zukunft im Geschäft bleiben will. Sie verstehen, daß sie die Schokoladenproduktion verbessern müssen. Deshalb sequenzieren sie das Genom der Kakaopflanze, zusammen mit IBM und dem US-amerikanischen Landwirtschaftsministerium. Sie wollen, daß man ihnen hilft, nachhaltig zu werden. Jetzt ist ihnen klar geworden, daß sie 320 Prozent mehr Kakao auf 40 Prozent weniger Land erzeugen können, wenn sie die genetischen Merkmale für Wachstum und Dürretoleranz identifizieren können. Das übrige Land kann dann für etwas anderes benutzt werden. Das heißt: mehr mit weniger oder noch mal weniger. So muß die Zukunft aussehen!« Und Rob Wallace bemerkt dazu: »Keine Hilfe bei seinem Streben nach Nachhaltigkeit will Mars allerdings von den Tausenden von Kindern, die für seine Zulieferer in Ghana und der Elfenbeinküste unter sklavenartigen Bedingungen Monokultur-Kakao anbauen. Beziehungsweise von den Tausenden Vertragsbauern dort, die in bitterer Armut leben und von dem Unternehmen keine Fairtrade-Preise erhalten. Jason Clay verteidigt Cargill und Mars mit dem Argument, die Agrarindustrie sei am besten in der Lage, Effizienzgewinne in der landwirtschaftlichen Produktion zu erreichen, um den Ressourcenverbrauch zu senken. Diese Annahme ist das zentrale Glaubensbekenntnis des grünen Kapitalismus. Aber sie ist bestenfalls ahistorisch und läßt die umfassende Zerstörung außer acht, die die Monokulturen der Agrarindustrie hervorgebracht haben. Ihre Effizienzgewinne werden häufig mit Einbußen an anderer Stelle erkauft, darunter so sentimentale 'Fixkosten' wie Menschenrechte, Gesundheit, Löhne und, um einen reduktionistischen Begriff zu verwenden, Ökosystemdienstleistungen.«****
2. Beispiel:
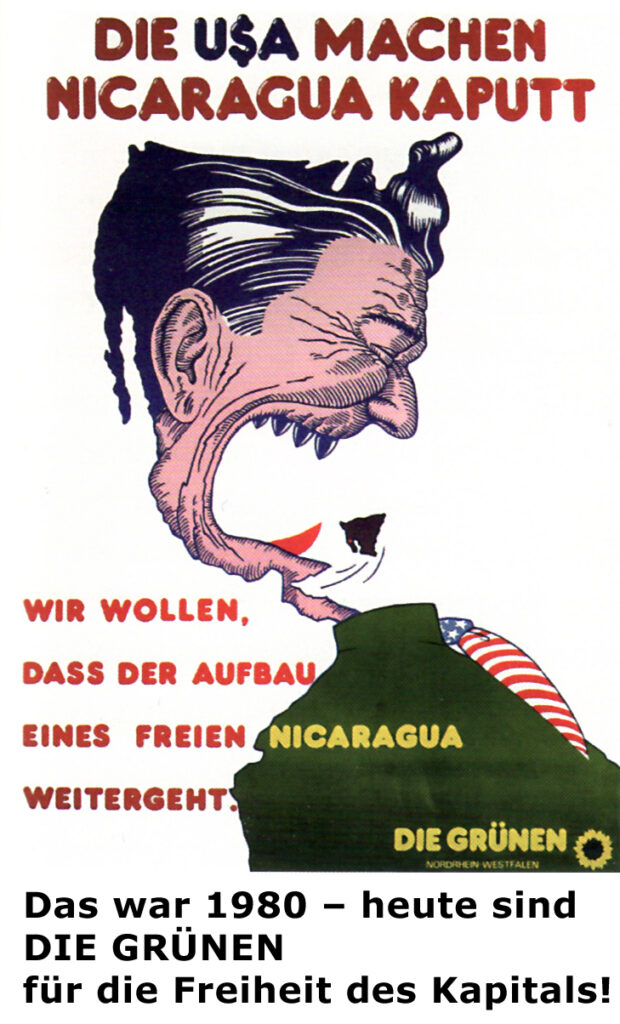 Die in der G7 versammelten imperialistischen Staaten wissen, daß die Aufrechterhaltung zum einen auf (frei)willigen Mitmachern beruht, zum anderen dies durch einen einsatzbereiten Gewaltapparat abgesichert werden muß. Deshalb versuchen diese Staaten mit ihren Geheimdiensten und mit ihnen verpflichteten Nichtregierungsorganisationen (NGO) in den Staaten Einfluß zu nehmen, wo es ihnen gerade nötig erscheint. Da keinen sie kein Tabu. Sozial- und Ökoorganisationen werden unterstützt und gegen unerwünschte Regierungen aufgehetzt. In Nicaragua beispielsweise führte die Bewegung insbesondere
Die in der G7 versammelten imperialistischen Staaten wissen, daß die Aufrechterhaltung zum einen auf (frei)willigen Mitmachern beruht, zum anderen dies durch einen einsatzbereiten Gewaltapparat abgesichert werden muß. Deshalb versuchen diese Staaten mit ihren Geheimdiensten und mit ihnen verpflichteten Nichtregierungsorganisationen (NGO) in den Staaten Einfluß zu nehmen, wo es ihnen gerade nötig erscheint. Da keinen sie kein Tabu. Sozial- und Ökoorganisationen werden unterstützt und gegen unerwünschte Regierungen aufgehetzt. In Nicaragua beispielsweise führte die Bewegung insbesondere
gegen das neue Kanalprojekt 2017 (finanziert von einem chinesischen Konsortium) zu Antiregierungsdemonstrationen, die dann 2018 anläßlich einer Rentenreform neu aufflammten. Die Demonstranten hatten sich dabei den falschen Adressat auserkoren: Jene anschließend zurückgenommene Reform war nämlich einem der berühmten IWF-Diktate geschuldet, womit die Vasallen des Imperialismus auf Kurs gehalten werden sollen. All diese Proteste führten dann zwar nicht zum Sturz der bei nachfolgenden Wahlen mit überwältigender Mehrheit bestätigten sandinistischen Regierung, wohl aber zu ihrer Diffamierung und Dämonisierung dieser durch die medialen Agenturen der Weltaufsichtsbehörden. Die FSLN weiß jedoch aus bitterer Erfahrung um die Verlogenheit der Behauptungen insbesondere aus den USA, die Umwelt und Mensch — gerade den nicht oder nicht länger ausbeutungsfähigen — als lästiges Vehikel ihrer Verwertungsmaschinerien betrachten. Für die Ortega-Regierung ergab sich freilich ein praktisches Problem beim Umgang mit den Demonstranten: Rädelsführer und naive Mitläufer mußten erst sortiert werden; letztere wurden freigelassen, erstere blieben inhaftiert und wurden später in ihr gelobtes Land ausgeflogen. Konsequenterweise wurden 2022 eine ganze Anzahl von NGOs verboten, Organisationen, die so »selbstständig« sind, daß sie vom imperialistischen Ausland finanziert werden.
3. Wie das imperialistische Vorgehen System hat, zeigt ein weiteres Beispiel:
In Tansania und Uganda soll eine neue Ölpipeline gebaut werden, um die Energieversorgung in küstenfernen Gebieten zu verbessern, ein Projekt, das von China mitfinanziert und -gebaut werden soll. Nun hat die Klimaorganisation »Letzte Generation« sich gegen dieses Projekt ausgesprochen*****, also ganz im Sinne der tonangebenden Staaten, die ihren Einfluß auf dem afrikanischen Kontinent schwinden sehen. Man muß nicht soweit gehen, um zu glauben, daß jene Organisation schon von staatlichen Stellen unterwandert ist. Doch umso schlimmer ist die schier unglaubliche Naivität, ihr offenbar völlig fehlendes poltisches Bewußtsein! Vom Zynismus, daß afrikanische Staaten das nicht haben sollen, was hierzulande selbstverständlich schon lange vorhanden ist, mal ganz abgesehen.
Und schließlich 4.
»Seit dem Beginn des Jahrhundert ist die Durchschnittstemperatur in meinem Land, dem Tschad, um mehr als 1,5° C angestiegen. Für die meisten Länder Afrikas gilt das gleiche. Unsere Bäume brennen. Unsere Wasservorkommen versiegen. Unsere fruchtbaren Äcker verwandeln sich in Wüste. Als indigene Frau lebte und arbeitete ich mit meiner Gemeinschaft stets im Einklang mit der Natur. Die Jahreszeiten, die Sonne, Wind und Wolken waren immer unsere Verbündeten. Inzwischen sind sie zu Feinden geworden,«******
Es liegt auf der Hand, daß die zerstörte Natur, die zerstörten Lebensbedingungen des Menschen selber zu den Fluchtursachen gehört, von denen die imperialistischen Staaten am liebsten nichts wissen wollen: So werden auch die restriktiven Maßnahmen begreifbar: Sie sind ihrer Ignoranz gegenüber den Ergebnissen ihrer eigenen Politik geschuldet. Der Rassismus, der mit den Flüchtlingen gefüttert wird, ist somit ein unabtrennbarer Teil der kapitalistischen Weltordnung und damit der Umweltzerstörung.
Und wenn man dann folgendes liest,
»Wissenschaftler aller Disziplinen sind sich einig, daß die Menschheit vor einem Abgrund steht. Der Klimawandel, die Versauerung der Ozeane, die Wasser- und Luftverschmutzung, Nitrat- und Fosfatbelastung, Störungen der Ozeanströmungen, all diese Elemente des Erdsystems haben entweder Kippunkte bereits überschritten oder nahem sich ihnen rasch an. Die drängendsten ökologischen und sozioökologischen Probleme sind die Zerstörung der Habitate, der Verlust biologischer Vielfalt, kollabierende Ökosysteme, neue Krankheiten, die Erschöpfung von Ressourcen, Peak Oil und zunehmende Schwierigkeiten bei der Energiegewinnung insgesamt, die Eutrofierung. der Gewässer, der Kollaps der Ozeane, die Verschlechterung der Bodenqualität, die Anreicherung von Giftstoffen in der Umwelt und natürlich die Klimaveränderungen. All das bedroht viele Pflanzen und Tierpopulationen, ohne die unsere Gattung nicht überleben kann. Die Umweltschäden sind nicht auf einzelne Biome beschränkt, sie haben globale Ausmaße….«
fragt man sich dann etwa nicht: Weshalb? Wollen jene Wissenschaftler dem Kapitalismus partout kein Haar krümmen? Sind für sie die westlichen Industriestaaten nach wie vor die richtige Adresse, an die sie ihren Aufschrei richten? Hat die Feststellung eines Mißstandes auch schon irgendetwas mit Kritik zu tun? Oder ist es nicht viel mehr eine Bestätigung der Politik, die mit nicht enden wollenden der Umwelt geschuldeten Konferenzen den status quo perpetuiert? Wird in Afrika beispielsweise der Hunger nicht schon seit der Entkolonisierung um 1960 bekämpft, ohne daß er beendet wurde? Ist das Umweltdesaster nicht schon in den 1970er Jahren breit bekannt geworden, ohne das sich daran etwas geändert hätte? Zeigt sich jetzt etwa nicht, daß Marx mit der Analyse des Kapitals nicht schon einen ganzen Schritt weiter war, die Katastrofe und ihr Ausmaß in eben dieser seiner Schrift als notwendig antizipierend?
02.05.2024,
Feedback: info@koka-augsburg.com
__________
* »Er [(Karl Nikolaus) Fraas, 1847] behauptet, daß mit der Kultur – entsprechend ihrem Grad – die von den Bauern so sehr geliebte Feuchtigkeit verlorengeht (daher auch die Pflanzen von Süden nach Norden wandern) und endlich Steppenbildung eintritt. Die erste Wirkung der Kultur nützlich, schließlich verödend durch Entholzung etc. Dieser Mann ist ebensosehr grundgelehrter Filolog (er hat griechische Bücher geschrieben) als Chemiker, Agronom etc. Das Fazit ist, daß die Kultur – wenn naturwüchsig vorschreitend und nicht bewußt beherrscht (dazu kommt er natürlich als Bürger nicht) – Wüsten hinter sich zurückläßt. Persien, Mesopotamien etc., Griechenland.« [Marx an Engels, MEW 32, S. 52]
** Kapital, Band 1, MEW 23, S. 536
*** Kapital, Band 1, MEW 23, S. 529. Das Wörtchen »daher« verweist auf Marx' ausführliche Begründung dieser Notwendigkeit!
**** in: Rob Wallace, Was Covid-19 mit der ökologischen Krise , dem Raubbau an der Natur und dem Agrobusiness zu tun hat, 2021 (2. A.), S. 125
***** (Pressemitteilung vom 18.03.24)
****** Hindou Oumarou Ibrahim, in: Carola Rackete, Handeln statt Hoffen, 2019, S. 10
die sozialistische-konzeption-des-menschen
Isaac Deutscher (1907-1967) wurde hierzulande insbesondere durch seine ausgezeichneten, lesenswerten Biografien Trotzkis und Stalins bekannt. Er hielt im Jahre 1966 bei einem TeachIn in den USA nachfolgenden Vortrag. Darin greift er bürgerliche Urteile über den Marxismus auf: Zum einen die Vorstellung, daß, insofern man einen Menschen in den Sozialismus verpflanzt, er aufgrund seiner Menschennatur dem nicht entsprechen könne, der Sozialismus also per se menschenwidrig sei. (Wie sollte das auch möglich sein bei einem Menschen mit seinen Vorurteilen und seinem Opportunismus, die ihn für den kapitalistischen Staat so wertvoll machen?) Zum anderen die Gleichsetzung der Sowjetunion und Chinas mit der Marxschen Kritik. Nachdem sowohl Rußland wie China mittlerweile zum Kapitalismus zurückgekehrt sind, gilt auch diese Kritik als endgültig erledigt… (24.04.24)
Isaac Deutscher
Die sozialistische Konzeption des Menschen
Marxisten widerstrebt es im allgemeinen, über den sozialistischen Menschen zu sprechen. Jeder Versuch, den Menschen der klassenlosen Gesellschaft der Zukunft zu porträtieren, hat notgedrungen einen utopischen Anstrich. Solche Beschreibungen waren die Domäne der großen Visionäre des Sozialismus, der Saint-Simon und Fournier, die wie die französischen Rationalisten des 18. Jahrhunderts glaubten, daß sie (und damit die Vernunft) endlich den idealen Menschen entdeckt hätten, und daß dieser Entdeckung nun unmittelbar die Verwirklichung folgen müsse. Nichts lag Marx und Engels und den bedeutenden Marxisten späterer Generationen ferner als dieser Gedanke. Sie verkündeten der Menschheit nicht: »Hier ist das Ideal, fallt vor ihm auf die Knie«, sie zeichneten kein Prospekt der zukünftigen Gesellschaft, sondern widmeten all ihre Kraft der gründlichen, realistischen Analyse der bestehenden, kapitalistischen Gesellschaft; den Klassenkampf ihrer Zeit vor Augen, weihten sie sich der Sache des Proletariats.
Bei aller Hingabe an die Erfordernisse ihrer Zeit kehrten sie aber der Zukunft nicht den Rücken. Sie versuchten, wenigstens die Umrisse der Zukunft zu erraten, aber sie formulierten ihre Vermutungen mit bemerkenswerter Zurückhaltung und auch das nur sehr selten. In ihren umfangreichen Schriften haben uns Marx und Engels nur wenige, verstreute Hinweise zu unserem Thema hinterlassen, bedeutsam aufeinander bezogene Andeutungen, die neue Horizonte eröffnen, aber eben nur Andeutungen. Zweifellos hatte Marx seine Vorstellung vom sozialistischen Menschen, aber das war die Arbeitshypothese des Analytikers, nicht die Erleuchtung eines Visionärs. Und obwohl er vom historischen Realismus seiner Antizipationen überzeugt war, stand er ihnen doch mit einer gewissen Skepsis gegenüber.
Marx suchte, nach seinen eigenen Worten, nach den Keinen des Sozialismus im Leibe des Kapitalismus; darum konnte er auch nur den Keim des sozialistischen Menschen sehen. Auf die Gefahr hin, Erwartungen zu enttäuschen, muß ich sagen, daß wir bis heute nicht mehr tun können. Nach all den Revolutionen unseres Zeitalters und trotz allem, was wir seit Marx über die Gesellschaft gelernt haben, sind wir in dieser Hinsicht nicht über ihn hinausgekommen. Was wir zum Problem des sozialistischen Menschen sagen können, bleibt notwendigerweise sehr allgemein, fragmentarisch und in bestimmter Weise negativ. Wir können leichter bestimmen, wie der sozialistische Mensch nicht sein wird, als wie er sein wird. Im gleichen Maße aber, wie eine Negation zugleich eine Position impliziert, weist negative Charakteristik des sozialistischen Menschen auch auf einige seiner positiven Züge hin.
Der Marxismus sieht den Hauptwiderspruch der bürgerlichen Gesellschaft, die wesentliche Ursache ihrer Anarchie und Irrationalität in dem Konflikt zwischen der zunehmenden Vergesellschaftung des modernen Produktionsprozesses einerseits und dem nicht gesellschaftlichen Charakter der Kontrolle, die das Privateigentum über diesen Prozeß ausübt. Die moderne Technik und Industrie tendieren zu einer Vereinigung der Gesellschaft, das Privateigentum an den Produktionsmitteln reißt sie auseinander. Der vergesellschaftete Produktionsprozeß — ein Stück Kollektivismus inmitten der neokapitalistischen Wirtschaft — muß von den bürgerlichen Eigentumsverhältnissen befreit werden, die ihn einzwängen und stören. Mehr als ein Jahrhundert hindurch waren bürgerliche Ökonomen blind für diesen Widerspruch, ehe Keynes und seine Schüler ihn in der ihnen eigenen, eklektischen Weise bemerkten und damit der Marxschen Kritik unfreiwilligen Tribut zollten.
Aber alles, was Keynesianismus und Neokapitalismus — die vom Gespenst des Kommunismus mehr denn je heimgesucht werden — tun können, ist der Versuch, auf Basis des Privateigentums (d.h. der monopolkapitalistischen Unternehmen) eine Art von pseudo-gesellschaftlicher Kontrolle über den vergesellschafteten Produktionsprozeß einzuführen. Es geschieht nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal, daß Menschen sich verzweifelt mühen, archaische Institutionen und Lebensweisen in ein Zeitalter hinüberzuretten, das sie nicht brauchen kann. In meiner Heimat Polen habe ich einmal einen Bauern gesehen, der zufällig ein altes Auto bekam, vor das er unbedingt seine Pferde spannen wollte. Keynesianismus und Neokapitalismus spannen die Pferde des Privateigentums vor die atomgetriebenen Fahrzeuge und Raumschiffe unserer Zeit und setzen Himmel und Hölle in Bewegung, um uns am Ausspannen zu hindern.
Unsere Konzeption des Sozialismus ist keine willkürliche, intellektuelle Konstruktion, sondern eine sorgfältige Extrapolation und Projektion jener Elemente rationaler sozialer Organisation, die bereits der kapitalistischen Gesellschaft inhärent sind, aber ständig von ihr durchkreuzt und negiert werden. In ähnlicher Weise ist unsere Vorstellung vom sozialistischen Menschen eine Projektion des gesellschaftlichen Menschen, der bereits der Möglichkeit nach in uns existiert, aber durch die Lebensbedingungen, unter denen er leben muß, verstümmelt, zerschlagen und widerlegt wird. (Der Keim des sozialistischen Menschen ist selbst im entfremdeten Arbeiter unserer Zeit gegenwärtig in den seltenen Augenblicken, wenn er seiner Rolle in der Gesellschaft bewußt wird, sich zur Klassensolidarität erhebt und für seine Befreiung kämpft.) So wurzelt unsere Zielvorstellung in der Wirklichkeit, wird von ihr bestärkt und bleibt in ihr befangen.
Wir wissen, was der sozialistische Mensch nicht sein wird: das Produkt einer antagonistischen Gesellschaft. Er wird nicht mehr der kollektive Produzent sein, der von seinem eigenen Produkt und seiner sozialen Lebenswelt kontrolliert wird, statt sie zu kontrollieren. Er wird nicht Spielball der blinden Kräfte des Marktes sein, noch Roboter einer staatlich organisierten, neokapitalistischen Kriegswirtschaft. Er wird nicht der entfremdete und geduckte Arbeiter früherer Tage sein, noch die langweilige Imitation des Kleinbürgers, wozu ihn unser sogenannter Wohlfahrtsstaat macht. Er kann nur zu sich selbst kommen als Kollektivarbeiter in einer höchst entwickelten, kollektivistischen Gesellschaft. Nur eine solche Gesellschaft erlaubt, die gesellschaftlich notwendige Arbeit auf ein erträgliches Minimum zu reduzieren, was die moderne Technik schon möglich macht. Erst in dieser Gesellschaft wird der sozialistische Mensch seine materiellen und geistigen Bedürfnisse in Sicherheit, nicht zufällig, befriedigen können, rational, nicht in bizarren Formen. Nur in dieser Gesellschaft wird er sich bei der Befriedigung seiner Bedürfnisse und beim Gebrauch seiner freien Zeit mittels durchgebildetem Differenzierungsvermögen und kluger Wahl selbst organisieren können, statt geheimen oder lautstarken Verführern der kommerziellen Reklame zu folgen. Nur in einer sozialistischen Gesellschaft wird der Mensch imstande sein, all seine biologischen und geistigen Fähigkeiten zu entwickeln, seine Persönlichkeit auszubilden und zu integrieren und sich von dem düsteren Erbe tausendjähriger materieller Knappheit, Ungleichheit und Unterdrückung frei zu machen. Nur in einer solchen Gesellschaft werden die Menschen endlich die Scheidung von fysischer und intellektueller Arbeit überwinden können, die die Ursache der Entfremdung des Menschen vom Menschen, der Aufteilung der Menschheit in Herrscher und Beherrschte, in antagonistische Klassen, war, die die fortgeschrittene Technik gerade jetzt überflüssig macht, während das neokapitalistische System daran arbeitet, sie mit allen Kräften zu verewigen. Erst auf dem Höhepunkt unserer Kultur und Zivilisation kann sich der sozialistische Mensch zu seiner vollen Größe erheben. Dieser Gipfelpunkt ist bereits in Sichtweite, aber unsere Eigentumsverhältnisse, die sozialen Institutionen und unser tief verwurzeltes Beharrungsvermögen hindern uns, uns so rasch wie möglich darauf zuzubewegen.
Unsere Vorstellung vom sozialistischen Menschen ist oft wegen ihres furchtlosen Optimismus kritisiert worden. Man sagt uns, auch wir seien Utopisten und unsere geschichts-filosofischen und psychologischen Annahmen seien unhaltbar. Man sagt, das »Paradies auf Erden«, von dem die Propagandisten des Sozialismus gesprochen haben, sei ebenso unerreichbar wie das himmlische Paradies, das die Theologen versprachen. Wir müssen dieser Kritik aufmerksam zuhören, manchmal sind ein paar Körnchen Wahrheit darin enthalten. Wir müssen zugeben, daß wir oft eine allzu optimistische Vorstellung hatten, wenn nicht vom Sozialismus, dann doch von den Wegen dahin. Aber wir müssen uns auch klarmachen, daß viele dieser kritischen Bemerkungen lediglich Produkte jener Untergangsstimmung sind, die die bürgerliche Gesellschaft und ihre Ideologen erfüllt, oder in irrational verarbeiteter Enttäuschung von Menschen aus unserem eigenen Lager ihre Wurzeln haben. Die Existentialisten sagen uns, daß wir den Grundbefindlichkeiten menschlichen Daseins entfliehen möchten und die unausweichliche Absurdität unseres Schicksals leugnen. Es ist außerordentlich schwierig, mit Gegnern, die unterm Aspekt der Ewigkeit und von rein teleologischen Prämissen her argumentieren. Der pessimistische Existentialist stellt die alte Frage: Was ist der Sinn oder das Ziel menschlicher Existenz und menschlichen Tuns, wenn man sie mit der Unendlichkeit von Zeit und Raum vergleicht? Darauf haben natürlich weder wir noch der Existentialist eine Antwort. Aber die Frage selbst ist sinnlos, da sie das Bedürfnis nach einem absoluten, metafysischen Zweck menschlicher Existenz postuliert, der für die Ewigkeit gilt. Einen solchen Zweck kennen wir nicht und wir haben auch kein Bedürfnis danach. Wir sehen in unserer Existenz weder metafysischen Sinn noch Absurdität — das sind übrigens nur zwei Seiten derselben Medaille; nur wo ein Sinn postuliert wird, kann man von Absurdität reden.
Das menschliche Leben, mit dem wir uns befassen, ist nicht die Einsamkeit des Menschen in der Unendlichkeit von Raum und Zeit. In dieser Unendlichkeit sind selbst die Begriffe Einsamkeit und Absurdität bedeutungslos. Wir beschäftigen uns mit der Lage des Menschen in einer Gesellschaft, die er selbst geschaffen hat und verändern kann. Das Argumentieren unterm Aspekt der Ewigkeit ist filosofisch steril und sozial reaktionär. Man kann damit moralische Indifferenz und politischen Quietismus rechtfertigen. Die filosofischen Argumente werden zu Argumenten für die resignierte Anerkennung der gesellschaftlichen Verhältnisse, wie sie sind. Glücklicherweise können Existentialisten — wie das bemerkenswerte Beispiel Sartres bezeugt — filosofisch inkonsequent sein und trotz ihrer Überzeugung von der Absurdität menschlicher Existenz die Idee vom sozialistischen Menschen akzeptieren.
Spezifischer ist die Kritik marxistischer und sozialistischer Hoffnungen, wie sie Sigmund Freud in seiner Schrift »Das Unbehagen in der Kultur«(1930) vorgenommen hat. Unserer Vorstellung davon, was der Mensch in einer Gesellschaft ohne Klassen und Staat sein kann, entgegnet Freud mit dem alten Spruch »homo homini lupus«, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Menschliche Wesen, sagt er, werden immer aggressiv und feindselig einander gegenüberstehen; ihre aggressiven Instinkte sind biologisch festgelegt und werden durch Änderungen der Gesellschaftsstruktur nicht wesentlich beeinflußt. »Die Kommunisten«, sagt Freud, »glauben den Weg zur Erlösung vom Übel gefunden zu haben. Der Mensch ist eindeutig gut, seinem Nächsten wohlgesinnt, aber die Einrichtung des privaten Eigentums hat seine Natur verdorben. Besitz an privaten Gütern gibt dem einen die Macht und damit die Versuchung, den Nächsten zu mißhandeln; der vom Besitz Ausgeschlossene muß sich in Feindseligkeit gegen den Unterdrücker auflehnen. Wenn man das Privateigentum aufhebt, alle Güter gemeinsam macht und alle Menschen an deren Genuß teilnehmen läßt, werden übelwollen und Feindseligkeit unter den Menschen verschwinden. Da alle Bedürfnisse befriedigt sind, wird keiner Grund haben, in dem anderen einen Feind zu sehen; der notwendigen Arbeit werden sich alle bereitwillig unterziehen.«
Ehe ich fortfahre, möchte ich zunächst prüfen, ob Freuds zusammenfassende Darstellung der marxistischen Ansichten korrekt ist. Glauben wir wirklich, daß der Mensch von Natur aus »eindeutig gut« und »seinem Nächsten wohlgesinnt« ist? Freud, der über die marxistische Theorie ziemlich schlecht informiert war, fand zweifellos derartige Behauptungen in der populären, kommunistischen oder sozialdemokratischen Propaganda. Die ernstzunehmende marxistische Theorie stellt hingegen keinerlei derartige Sätze über die Menschennatur auf; am ehesten kann man die Quelle solcher Anschauungen in den feuerbachianischen Jugendschriften von Marx auffinden. Ich erinnere mich, daß mich dies Problem als junger Mensch sehr beschäftigt hat, als ich mich mit marxistischer Theorie anfreundete und über die der Theorie zugrunde liegende Konzeption der menschlichen Natur ins Klare kommen wollte. Nachdem ich mich durch die Schriften von Marx, Engels, Kautsky, Plechanow, Mehring, Rosa Luxemburg, Lenin, Trotzki und Bucharin hindurchgelesen hatte, kam ich zu dem Schluß, daß deren Annahmen über die menschliche Natur wesentlich »neutral« waren. Sie hielten den Menschen weder für »eindeutig gut«, noch für »eindeutig schlecht« und weigerten sich, die metafysischen Vorstellungen einer unwandelbaren, von sozialen Bedingungen unbeeinflußten Menschennatur zu akzeptieren. Ich bin immer noch der Meinung, daß dieser Schluß, zu dem ich damals vor vierzig Jahren kam, richtig ist.
Der Mensch ist Produkt der Natur, speziell jener Natur, die sich als menschliche Gesellschaft der außermenschlichen Natur entgegenstellt. Wie immer die biologische Basis unseres Lebens beschaffen sein mag, — die sozialen Verhältnisse spielen die entscheidende Rolle bei der Formung unseres Charakters, und selbst die biologischen Faktoren werden durch unsere soziale Persönlichkeit gebrochen und teilweise umgeformt. Die menschliche Natur und ihre Triebe sind bisher durch die sozialen Bedingungen in starkem Maße unterdrückt und entstellt worden, und nur wenn diese Bedingungen ihre unterdrückende und verzerrende Qualität verlieren, werden wir eine deutlichere und wissenschaftlichere Vorstellung von den biologischen und sozialen Elementen der Menschennatur haben als bisher.
Die wesentliche Kritik an Freuds Theorie, die ein Marxist üben muß […] bezieht sich darauf, daß Freud und seine Schüler nur zu oft diese Brechung und Transformation der Triebe des Menschen durch seine sich wandelnde soziale Identität unberücksichtigt lassen, — und dabei war es Freud, der uns auf die Prozesse der Sublimierung aufmerksam gemacht hat. Die Psychoanalyse konnte sich bisher nur mit dem bürgerlichen Menschen der imperialistischen Epoche befassen. Sie präsentierte ihn als den Menschen schlechthin, behandelte seine inneren Konflikte in überhistorischer Manier als Konflikte von Menschen aller Epochen, aller sozialen Ordnungen, — als der menschlichen Existenz inhärente Konflikte. Unter diesem Aspekt kann der sozialistische Mensch nur als eine Variation des bürgerlichen Menschen erscheinen. Freud selbst sagt dazu: »Mit der Aufhebung des Privateigentums entzieht man der menschlichen Aggressionslust eines ihrer Werkzeuge, gewiß ein starkes und gewiß nicht das stärkste. An den Unterschieden von Macht und Einfluß, welche die Aggression für ihre Absichten mißbraucht, daran hat man nichts geändert, auch an ihrem Wesen nicht.« Dann macht er folgende, noch weitaus kategorischere Aussage: »Sie (die Aggression) ist nicht durch das Eigentum geschaffen worden, herrschte fast uneingeschränkt in Urzeiten, als das Eigentum noch sehr armselig war, zeigte sich bereits in der Kinderstube, kaum daß das Eigentum seine anale Urform aufgegeben hat. … Räumt man das persönliche Anrecht auf dingliche Güter weg, so bleibt noch das Vorrecht aus sexuellen Beziehungen, das die Quelle der stärksten Mißgunst und der heftigsten Feindseligkeit unter den sonst gleichgestellten Menschen werden muß.« Freud warnt uns also, der sozialistische Mensch werde nicht weniger als der bürgerliche aggressiv und feindselig gegen seine Mitmenschen sein, und seine Feindseligkeit werde sich selbst im Kindesalter zeigen.
Freud sieht im Privateigentum ein starkes Aggressionsinstrument, aber er behauptet in dogmatischster Weise, daß es nicht das stärkste sei. Woher weiß er das? Wie mißt er die relative Stärke der verschiedenartigen Aggressionsinstrumente? Wir Marxisten sind darin bescheidener und weniger dogmatisch: Wir behaupten nicht, vergleichende Messungen angestellt zu haben, die es uns gestatten würden, sexuelle Triebe und triebhafte Aggression gegen soziale Bedürfnisse, Interessen und Zwänge abzuwägen. Die biologischen Triebe werden beim sozialistischen Menschen so wie beim heutigen gegeben sein, aber wir wissen nicht, in welcher Brechung sie in seiner Persönlichkeit zum Ausdruck kommen werden. Wir können nur vermuten, daß sie ihn in einer anderen Weise motivieren werden als den bürgerlichen Menschen. (Ich vermute sogar, daß der sozialistische Mensch dem Psychoanalytiker reicheres und verläßlicheres Material für Forschung und Theorie liefern wird, weil ein künftiger Freud in ihm die Arbeit der Triebe direkter beobachten können wird, nicht durch eine dunkle Brille, durch die verzerrenden Prismen der Klassenpsychologie des Analytikers und seines Patienten.) Freud irrt sich auch, wenn er das Eigentum lediglich ein Instrument unserer aggressiven Instinkte nennt. Im Gegenteil: das Eigentum nutzt jene Instinkte häufig als Instrumente und entwickelt seine eigene Vielfalt von aggressiven Trieben. Ferner haben sich in der Geschichte in Armeen organisierte Menschen gegenseitig abgeschlachtet wegen des Eigentums oder wegen Eigentumsforderungen, aber sie haben bisher — außer in der Mythologie — keine Kriege wegen sexueller Privilegien geführt.
Wenn Freud behauptet, daß die Abschaffung des Eigentums »die Unterschiede von Macht und Einfluß, welche die Aggression für ihre Absichten mißbraucht«, ebensowenig ändern wird wie »die Natur der menschlichen Aggression«, so bleibt er den Beweis schuldig. Und wenn er schreibt, daß »Aggression … fast uneingeschränkt in Urzeiten herrschte, als das Eigentum noch sehr armselig war«, so entgeht ihm, daß es gerade die materielle Knappheit war, die die Einheit der primitiven Gesellschaft zerstörte, weil sie grausame Kämpfe um knappe Ressourcen auslöste, die die Gesellschaft in antagonistische Klassen spaltete.
Gerade deshalb halten wir daran fest, daß der sozialistische Mensch nur vorstellbar ist auf der Basis eines beispiellosen Überflusses von materiellen und kulturellen Gütern und Dienstleistungen. Das ist das ABC des Marxismus. Einer meiner Freunde, ein alter, weiser Psychoanalytiker, sagt oft seufzend: »Wenn doch Freud Engels ›Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates‹ gelesen hätte; – er hätte manche Umwege und Irrtümer vermeiden können!« Er hätte dann jedenfalls denen keine Munition geliefert, für die das ›homo homini lupus‹ der Schlachtruf gegen Fortschritt und Sozialismus ist, und die mit dem Buhmann der ewigen menschlichen Wolfsnatur im Interesse des realen, blutrünstigen imperialistischen Wolfes operieren. […]
Er scheint freilich andere Möglichkeiten geahnt zu haben: »Hebt man auch dieses« (das Vorrecht aus sexuellen Beziehungen) »durch die völlige Befreiung des Sexuallebens (auf), beseitigt also die Familie, die Keimzelle der Kultur, so läßt sich nicht vorhersehen, welche neuen Wege die Kulturentwicklung einschlagen kann…« Diese Perspektive kann er sich jedoch nicht vorstellen, da ihm die monogame Familie als Keimzelle der Kultur gilt; er kann sich nicht lösen von seinem Patienten, dem bürgerlich monogamen Menschen, der vor ihm auf der Couch liegt. Obwohl er mit Unbehagen zugesteht, daß wir nicht vorhersehen können, welche neuen Wege der Kulturentwicklung sich nach Beseitigung der gegenwärtigen Familieninstitutionen ergeben werden, ist er doch sicher, daß die unaufhebbare Destruktivität der Menschennatur auch den sozialistischen Menschen heimsuchen wird, jenseits von Klasse, Gesellschaft, Staat und Familie.
Wir Marxisten bescheiden uns hier wiederum mit einem Stück Unwissenheit. Wir haben natürlich in erster Linie mit jener Grausamkeit und Unterdrückung zu tun, die direkt durch Armut, Knappheit am Gütern, die Klassengesellschaft und die Herrschaft von Menschen über Menschen verursacht wird. Wann immer Freud sich auf das Gebiet der Soziologie und Geschichte begibt, sitzt er dem Vorwurf auf, willentlich oder unwillentlich die bestehende Gesellschaft zu rechtfertigen. […]
Wir sagen nicht, daß der Sozialismus alle Probleme der menschlichen Gattung lösen wird. Wir kämpfen in erster Linie gegen Übel, die der Mensch angerichtet hat, und die er bewältigen kann. […] Wenn wir gegen soziale Ungleichheit und Unterdrückung kämpfen, kämpfen wir zugleich für eine Milderung der Schläge, die die Natur uns versetzt. Ich meine, daß der Marxismus die Probleme unserer Gesellschaft am richtigen Ende anpackt. […] Unsere Vorstellung vom sozialistischen Menschen inspirierte hingegen [gegen die Freudianer] einen riesigen Teil der Menschheit, und obwohl wir mit wechselndem Erfolg gekämpft haben und schreckliche Niederlagen erlitten, haben wir doch Berge versetzt, während alle Psychoanalyse dieser Erde die überkochende Aggressivität unserer Zeit nicht um ein Jota vermindern kann.
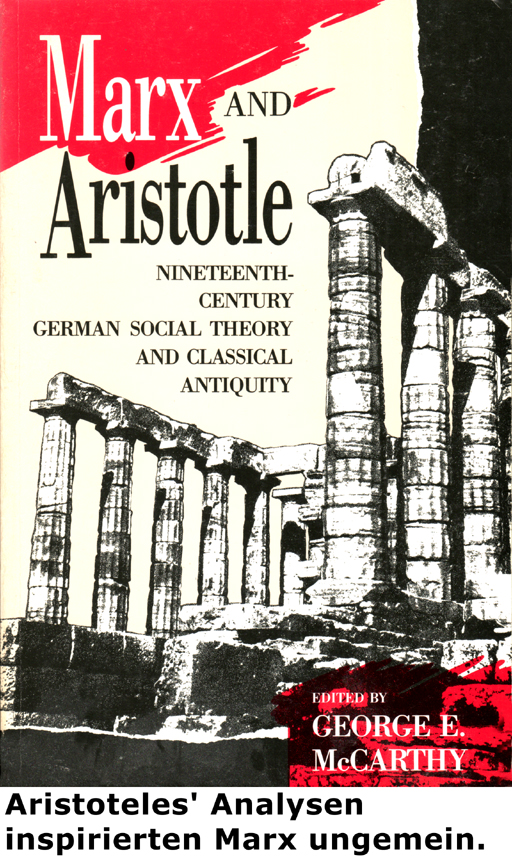 Auch für den sozialistischen Manschen, werden natürlich Sexualität und Tod Probleme darstellen, aber wir sind sicher, daß er ihnen besser ausgerüstet entgegentreten wird. Und sollte sein Wesen aggressiv bleiben, so wird ihm seine Gesellschaft ungleichlich vielfältigere und bessere Möglichkeiten zur Triebsublimierung bieten, als sie dem Individuum in der bürgerlichen Gesellschaft zur Verfügung standen. Auch wenn der sozialistische Mensch nicht ganz »frei sein wird von Schuld und Schmerz«, wie Shelley träumte, mag er doch »zepterlos, frei und unbeschränkt sein, ein gleicher Mensch, nicht in Klasse, Stamm, Nation eingezwängt, frei von Götzendienst und Gottesfurcht.« Das durchschnittliche Mitglied der sozialistischen Gesellschaft wird sich – wie Trotzki antizipierte – zur Größe eines Aristoteles oder Marx erheben, die – wie immer ihre Triebstruktur beschaffen war – die großartigsten bisher erreichten Entwicklungen unserer Gattung repräsentieren. Und wir vermuten, daß sich »über diesen Höhen neue Gipfel erheben werden«. Wir sehen im sozialistischen Menschen nicht das letzte, vollkommenste Produkt der Entwick-lung oder das Ende der Geschichte, sondern den eigentlichen Anfang der Geschichte. Der sozialistische Mensch mag das »Unbehagen« fühlen, die Unruhe und Qual, die die Kultur dem Tier im Menschen aufbürdet. Es kann sogar im Zentrum seiner inneren Widersprüche und Spannungen stehen, die ihn dazu treiben, ein Niveau zu erreichen, das einstweilen jenseits unserer Vorstellungskraft liegt.
Auch für den sozialistischen Manschen, werden natürlich Sexualität und Tod Probleme darstellen, aber wir sind sicher, daß er ihnen besser ausgerüstet entgegentreten wird. Und sollte sein Wesen aggressiv bleiben, so wird ihm seine Gesellschaft ungleichlich vielfältigere und bessere Möglichkeiten zur Triebsublimierung bieten, als sie dem Individuum in der bürgerlichen Gesellschaft zur Verfügung standen. Auch wenn der sozialistische Mensch nicht ganz »frei sein wird von Schuld und Schmerz«, wie Shelley träumte, mag er doch »zepterlos, frei und unbeschränkt sein, ein gleicher Mensch, nicht in Klasse, Stamm, Nation eingezwängt, frei von Götzendienst und Gottesfurcht.« Das durchschnittliche Mitglied der sozialistischen Gesellschaft wird sich – wie Trotzki antizipierte – zur Größe eines Aristoteles oder Marx erheben, die – wie immer ihre Triebstruktur beschaffen war – die großartigsten bisher erreichten Entwicklungen unserer Gattung repräsentieren. Und wir vermuten, daß sich »über diesen Höhen neue Gipfel erheben werden«. Wir sehen im sozialistischen Menschen nicht das letzte, vollkommenste Produkt der Entwick-lung oder das Ende der Geschichte, sondern den eigentlichen Anfang der Geschichte. Der sozialistische Mensch mag das »Unbehagen« fühlen, die Unruhe und Qual, die die Kultur dem Tier im Menschen aufbürdet. Es kann sogar im Zentrum seiner inneren Widersprüche und Spannungen stehen, die ihn dazu treiben, ein Niveau zu erreichen, das einstweilen jenseits unserer Vorstellungskraft liegt.
Die vorgetragenen Anschauungen sind oder sollten für jeden Marxisten selbstverständlich sein und ich muß mich vielleicht entschuldigen, daß ich sie auf einer Konferenz wie der unseren (Socialist Scholars‘ Conference) wiederhole. Beim gegenwärtigen Stand der Arbeiterbewegung und des sozialistischen Denkens müssen jedoch bestimmte elementare Einsichten wiederholt werden, weil sie vergessen oder verfälscht werden um zweifelhafter politischer Vorteile willen. So wurde mir z.B. gesagt, der eigentliche Gegenstand meiner Analyse müsse jener sozialistische Mensch sein, der heute in der UdSSR oder in China lebt. Ich könnte diesen Standpunkt nur dann teilen, wenn ich der Meinung wäre, daß diese Länder den Sozialismus bereits weitgehend oder gänzlich erreicht hätten. Diese Vorstellung kann ich nicht teilen und ich glaube nicht, daß das typische oder auch das fortgeschrittene Mitglied der sowjetischen oder der chinesischen Gesellschaft von heute als sozialistischer Mensch beschrieben werden kann.
Wir alle reden natürlich üblicherweise von der UdSSR, China und den Verbündeten oder nichtverbündeten Staaten gleichen Typs als von »sozialistischen Ländern«, und wir können das tun, solange wir den nach-kapitalistischen Charakter dieser Regime (im Gegensatz zu den kapitalistischen) meinen oder auf die sozialistischen Ursprünge bzw. die Leitideen ihrer Regierung und Politik hinweisen wollen. Hier aber geht es mir um eine theoretisch präzise Beschreibung der Struktur ihrer Gesellschaft und der Verhältnisse zwischen den Menschen, wie sie sich innerhalb dieser Struktur entwickeln. Vor mehr als 30 Jahren verkündete Stalin, die Sowjetunion habe den Aufbau des Sozialismus beendet; trotz Entstalinisierung und trotz des Abbaus vieler stalinistischer Mythen ist das ein zentraler Glaubenssatz der offiziellen sowjetischen Ideologie geblieben. Mehr noch, Stalins Nachfolger behaupten, die Sowjetunion befinde sich jetzt im Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus, sie trete in den höheren Zustand der klassenlosen Gesellschaft ein, der den Zyklus sozialistischer Transformation abschließt, der durch die Oktoberrevolution eingeleitet wurde.
Sprecher der Volksrepublik China haben ähnliche Ansprüche für ihr Land erhoben. Das stalinistische Dogma vom vollendeten Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion hat die populäre Vorstellung vom sozialistischen Menschen in starkem Maße beeinflußt und verändert, sogar das Denken einiger Sozialisten. Eins aber ist klar oder sollte doch klar sein: der typische Mensch der sowjetischen Gesellschaft, ob unter Stalin oder unter seinen Nachfolgern, steht in so schlagendem Gegensatz zur marxistischen Konzeption vom sozialistischen Menschen, daß wir ihn entweder nicht als solchen bezeichnen können oder
aber die marxistische Konzeption über Bord werfen müssen, wie die stalinistische Doktrin es stillschweigend getan hat. Es geht uns hier nicht um den Buchstaben des Evangeliums sondern um eine Frage von größter theoretischer und praktischer Bedeutung. Wenn unser Ziel der sozialistische Mensch ist, dann ist unsere Konzeption dieses sozialistischen Menschen wesentlich für unser theoretisches Denken, für das moralisch-politische Klima der Arbeiterbewegung und für unsere eigene Fähigkeit oder Unfähigkeit, unsere Arbeiterklasse zu inspirieren.
Der sozialistische Mensch wurde von Marx und seinen Schülern – vor Stalin – als frei assoziierter Produzent gesehen, der selbst auf der sogenannten unteren Stufe des Kommunismus in einer rational geplanten Wirtschaft arbeitet, nicht länger mehr der Käufer oder Verkäufer ist, der seine Produkte auf dem Markt handelt, sondern Produzent von Gütern für die Gesamtgesellschaft, der das, was er zu persönlichem Verbrauch benötigt, aus dem gemeinsamen Vorrat der Gesellschaft erhält. Per definitionem lebt der sozialistische Mensch in einer klassenlosen Gesellschaft ohne Staat, frei von sozialer oder politischer Unterdrückung, auch wenn er anfänglich noch eine – allmählich schwindende – Last ererbter sozialer Ungleichheit zu tragen hat. Die Gesellschaft, in der er leben kann, muß so weit entwickelt sein, so wohlhabend, gebildet und zivilisiert sein, daß es kein objektivesBedürfnis, keine Notwendigkeit gibt, die zum Wiederaufleben von Ungleichheit oder Unterdrückung führen.
Das hielten alle Marxisten vor Stalin für selbstverständlich. Dies Ideal inspirierte Generationen von Sozialisten, ohne es hätte der Sozialismus als geschichtsmächtige Kraft des Jahrhunderts nie das Licht der Welt erblickt. Der Marxismus hat den realistischen Charakter dieses Ideals demonstriert; er zeigte, daß die gesamte Entwicklung der modernen Gesellschaft mit ihrer Technologie, Industrie und dem zunehmend vergesellschafteten Produktionsprozeß auf dies Ziel hintendiert. Der sozialistische Mensch aber, den Stalin und seine Nachfolger der Welt präsentierten, ist eine klägliche Parodie auf die marxistische Konzeption. Es ist richtig: der sowjetische Bürger lebt in einer Gesellschaft, wo der Staat und nicht die Kapitalisten die Produktionsmittel besitzt, und das spiegelt sich bereits in einigen fortschrittlichen Zügen seiner Mentalität. Selbst die zurückgebliebensten sowjetischen Arbeiter halten das öffentliche Eigentum an den Produktionsmitteln für selbstverständlich. Der private Besitz einer Fabrik oder eines Bergwerks erscheint ihm als empörendes Relikt aus barbarischer Vergangenheit. Er schaudert beim bloßen Gedanken daran. Er blickt darauf zurück wie der durchschnittliche Mensch der bürgerlichen Gesellschaft auf die Sklaverei – ein gesellschaftliches Verhältnis, das den Menschen erniedrigt. Aber diese fortschrittlichen Züge in der Einstellung des sowjetischen Menschen sind nicht die vor-
herrschenden Züge seines Sozialcharakters.
Die sowjetische Gesellschaft litt und leidet noch unter materieller Knappheit, in erster Linie an extremer Konsumgüterknappheit. Das führte im Laufe von Jahrzehnten zu einem unvermeidlichen Wiederaufleben und zur Verstärkung der sozialen Ungleichheit, zu einer tiefen Kluft zwischen einer privilegierten Minderheit und einer beraubten Mehrheit, zum spontanen Wiedererstehen der ökonomischen Kräfte des Markts und zur Erneuerung und zu furchterregendem Anwachsen der Unterdrückungsfunktionen des Staates. Der sozialistische Mensch, den Stalin der Welt präsentierte, war der hungrige, schlechtgekleidete, schlecht beschuhte oder barfüßige Arbeiter, der Bauer, der auf dem schwarzen oder grauen Markt ein Hemd, ein Möbelstück, ein paar Unzen Mehl oder auch nur ein Stück Brot kaufte oder verkaufte; der täglich zehn oder zwölf Stunden unter einer kasernenähnlichen Fabrikdisziplin arbeitete und manchmal für irgendein wirkliches oder vorgebliches Vergehen mit jahrelanger Zwangsarbeit im Konzentrationslager zahlen mußte. Er wagte nicht, einen Fabrikdirektor zu kritisieren, schon gar nicht einen Parteiboß. Er hatte nicht das Recht, irgendeine Meinung zu einem größeren Problem zu äußern, das sein oder seines Landes Schicksal betraf. Er hatte zu wählen, wie man es ihm befahl, dem Führer mit frenetischem Beifall zu applaudieren, seine Würde und Persönlichkeit durch den sogenannten Personenkult verhöhnen zu lassen. Das sind die Tatsachen, die gegenwärtig offiziell von den sowjetischen Führern beschrieben werden und sich in einer umfangreichen sowjetischen Literatur von größter Authenzität widerspiegeln. Und obwohl sich die Bedingungen in den vergangenen Jahren sehr verändert haben, sind Armut, Ungleichheit, Mangel an politischer und intellektueller Freiheit und der bürokratische Terror noch immer vorhanden.
Ich rufe all das nicht aus polemischen Gründen ins Gedächtnis zurück, schon weil ich die Hauptursache für diese Zustände nicht im bösen Willen der Herrschenden sehe – an dem es freilich nicht gefehlt hat –, sondern in den objektiven Bedingungen, in der überkommenen schrecklichen Armut, die die Sowjetunion (und jetzt China) unter den Bedingungen der Isolation, der Blockaden, Kriege und des Wettrüstens zu überwinden hatte. Es stand überhaupt nicht zur Debatte, daß ein Land wie dieses unter diesen Bedingungen fähig sein könne, den Sozialismus zu erreichen. Es mußte all seine Kräfte der »ursprünglichen Akkumulation« widmen, d.h. der Herstellung der wichtigsten ökonomischen Vorbedingungen unter Staatseigentum für den Aufbau eines wirklichen Sozialismus. Folglich ist die Sowjetunion auch heute noch eine Übergangsgesellschaft, irgendwo zwischen Kapitalismus und Sozialismus, die Merkmale der einen wie der andern Gesellschaft kombiniert und sogar noch Spuren ihres noch primitiveren vorkapitalistischen Erbes zeigt. Das gleiche gilt leider auch für China, Vietnam, Nordkorea und den größten Teil Osteuropas.
Wir im Westen tragen eine schwere Verantwortung für die schlechte Lage dieser Gesellschaften; unser Versagen, den Sozialismus im Westen voranzutreiben, war die wesentliche Ursache ihres Mißlingens. Aber wenn wir unsere Aufgabe neu überdenken, um eine neue Generation von Sozialisten instand zu setzen, den Kampf aufzunehmen, müssen wir unsere Vorstellungswelt gründlich von den falschen Vorstellungen und Mythen über den Sozialismus befreien, die in den letzten Jahrzehnten aufgekommen sind. Wir müssen den Sozialismus ein für alle Mal nicht von der Sowjetunion oder China und ihren fortschrittlichen sozialen Errungenschaften, sondern von der stalinistischen und nachstalinistischen Parodie auf den sozialistischen Menschen ablösen.
Ich kann hier nicht auf die dogmatischen und Prestige-Motive eingehen, die Stalin und seinesgleichen zu der Behauptung veranlaßten, die Sowjetunion habe den Sozialismus erreicht, und die noch seine Nachfolger zur Aufrechterhaltung dieser Legende drängen. Ich will nur von dem Einfluß sprechen, den dieses Dogma, diese Prahlerei auf den westlichen Sozialismus hatte. Dieser Einfluß war verheerend. Er hat unsere Arbeiterbewegung demoralisiert und das sozialistische Denken verwirrt. Unsere arbeitenden Klassen haben mit der ihnen eigenen Klugheit die Entwicklung in der Sowjetunion beobachtet und ihre
eigenen Schlußfolgerungen daraus gezogen. »Wenn das das Ideal des sozialistischen Menschen ist«, sagten sie am Ende, »dann wollen wir nichts damit zu tun haben«. Viele unserer sozialistischen Intellektuellen reagierten ebenso oder sie wurden von der stalinistischen Mythologie und Scholastik dermaßen eingefangen, daß ihnen die Kraft ihrer sozialistischen Überzeugung verlorenging und sie sich selbst geistig soweit entwaffneten, daß sie unfähig wurden, gegen die Enttäuschung und Apathie der arbeitenden Klassen zu kämpfen.
Von den Jesuiten hat man gesagt, sie hätten, weil es ihnen nicht gelang, die Erde zum Himmel zu erheben, den Himmel auf die Erde heruntergezogen. In ähnlicher Weise haben Stalin und der Stalinismus, unfähig, das mit Armut geschlagene, elende Rußland zum Sozialismus zu führen, den Sozialismus auf das Niveau des russischen Elends heruntergebracht. Man könnte sagen, daß sie es tun mußten. Selbst wenn das stimmte, müssen wir etwas anderes tun: wir müssen den Sozialismus auf sein eigenes Niveau zurückbringen.
Wir müssen unseren arbeitenden Klassen und den Intellektuellen erklären, warum die Sowjetunion und China den sozialistischen Menschen nicht schaffen konnten, trotz ihrer bemerkenswerten Errungenschaften, für die wir ihnen Anerkennung und Respekt schulden. Wir müssen der Idee des sozialistischen Menschen ihre Aura wiedergeben. Wir müssen sie zuerst für unser Bewußtsein wiederherstellen und dann sozialistisches Bewußtsein und sozialistische Theorie mit gestärkter Überzeugung und mit neuen politischen Waffen in die Arbeiterklasse hineintragen.
[Nach dem Vortrag von Deutscher wurde ein Brief von Herbert Marcuse verlesen. Dann sprachen die Referenten Robert S. Cohen, Shane Nage, Donald McKelvey und Robert P. Wolff. Es folgten Fragen und Kommentare aus dem Publikum. Isaak Deutscher hatte das Schlußwort.]
Ich bin noch dabei, die schmerzliche Überraschung, die mir der erste Teil der Diskussion bereitet hat, zu überwinden. Man lernt selbst in meinem Alter noch dazu, man lernt nie aus. Ich bin den beiden letzten Sprechern dankbar, die mein Gefühl für Realität wieder einigermaßen hergestellt haben. Ob ich mit ihnen übereinstimme oder nicht, wir können darüber diskutieren. Dennoch glaube ich, daß ich vor allem auf die Redner des ersten Teils der Diskussion eingehen muß, da ich hier ein beunruhigendes Symptom jenes schöpferischen intellektuellen Ferments sehe, das die Köpfe der amerikanischen Intelligenz, der jungen Generation der amerikanischen Wissenschaftler erfüllt. Es gibt davon seltsame Nebenprodukte, die mir wirklich außerordentlich gefährlich erscheinen. Ich bin fast verdutzt über die Thesen Professor Marcuses. Da die ersten Redner eine Art von unterstützendem Chorus für ihren abwesenden Lehrer bildeten, muß ich mich leider auf Professor Marcuses Erklärung konzentrieren. Er bringt drei oder vier bedeutende Gesichtspunkte, aber in so vager und schwer zu fassender Art, daß die Diskussion ziemlich erschwert wird. Zunächst einmal stellt er fest, daß wir Marx und dem Marxismus weit
voraus sind, daß unsere fortgeschrittene westliche Gesellschaft den Marxismus überflüs-sig gemacht hat, und daß wir folglich über den Marxismus irgendwie hinausgehen müssen. Ich bin immer geneigt, ja zu sagen, wenn mir jemand sagt, der Marxismus sei sicher nicht das letzte Wort in der Entwicklung des menschlichen Denkens und wir müßten über den Marxismus hinausgehen. Das ist ein sehr marxistisches Argument gegen den Marxismus, und ich bin geneigt, ihm zuzustimmen. Aber man muß auch einen Augenblick darüber nachdenken, in welcher Beziehung der Marxismus wirklich so überholt ist und wohin wir über ihn hinausgehen sollen.
Zuerst muß ich die Frage stellen, ob der Hauptwiderspruch der kapitalistischen Gesellschaft, wie ihn der Marxismus analysiert und diagnostiziert hat — der Widerspruch zwischen dem vergesellschafteten Produktionsprozeß und der unsozialen Kontrolle der Produktion durch private Eigentümer — überwunden worden ist. Wird er nicht immer tiefer und irrationaler mit jedem Jahrzehnt? Man sagt uns, die fortgeschrittene amerikanische Gesellschaft habe die marxistische Analyse des Kapitalismus veralten lassen. Trifft das wirklich für diese Gesellschaft zu, die ihr Gleichgewicht und ihre Produktion nur durch beinahe permanente Kriegführung aufrechterhält? Ich verstehe einfach die logischen oder auch unlogischen Denkprozesse nicht, vermöge deren man zu solchen Schlüssen kommen kann. Man sagt uns, eine Diagnose, die auf der Basis der Technologie von 1867 gestellt wurde, könne man 1966 nicht aufrechterhalten. Darum hätten wir den Marxismus weit hinter uns gelassen. Mein Argument dagegen ist, daß Marx geistig seiner Zeit und der Gesellschaft, in der er lebte, soweit voraus war, daß wir selbst heute noch in gewisser Beziehung hinter ihm herhinken. Man braucht nur unserer Debatte zuzuhören, um einen Beleg dafür zu haben.
Marx hat tatsächlich vor 100 Jahren für den Sozialismus eine technologisch weit entwickelte Gesellschaft vorausgesetzt, die imstande wäre, einen solchen Überfluß von Gütern zu produzieren, daß für sein Jahrhundert selbst die Vision einer solchen Gesellschaft utopisch war. Analysierte man die Statistiken der ProKopf-Produktion in den fortgeschrittensten kapitalistischen Ländern des 19. Jahrhunderts, so käme man zu dem Schluß, daß — sofern die sozialistische Revolution damals gesiegt hätte — sie (nach unserm heutigen Standard) in einem unterentwickelten Land gesiegt hätte. Das kann man Marx vorwerfen, daß er intellektuell seiner Zeit so weit voraus war, daß wir ihn noch immer nicht eingeholt haben.
Man sagt, Marx habe keine Gesellschaft vorhergesehen, in der Kybernetik, Maschinen und Computer in solchem Maße die Arbeit von Menschen ersetzen, wie es gegenwärtig der Fall ist. Marx habe keine Gesellschaft vorhergesehen, in der die Wissenschaftler, die führenden Wissenschaftler so bedeutend sein würden. Aber Marx nahm im Gegenteil immer an, daß seine Gesellschaft bereits im Begriff sei, eine solche Gesellschaft zu werden, und darin hatte er recht. Es ist richtig, daß eine vor 100 Jahren formulierte Theorie in mancher Hinsicht veraltet sein muß, obwohl diejenigen, die das sagen, am Ende meist — sofern sie uns nicht gerade Drogen zur »Befreiung« von der Unterdrückung dieser Gesellschaft empfehlen — für eine Rückkehr zu vormarxistischen Ideen plädieren, manchmal für eine Rückkehr zum Christentum, das 2000 Jahre älter ist als der Marxismus.
Wenn wir es mit sehr gebildeten und aufgeklärten Kritikern des Marxismus zu tun haben, bieten sie uns häufig eine Rückkehr, eine Regression — aber keine infantile — zum utopischen Sozialismus oder zum Rationalismus des 18. Jahrhunderts an. Aber es gibt bestimmte Revolutionen im menschlichen Denken, die nicht rückgängig zu machen sind. Niemand kann zum vor-kopernikanischen System der Kosmologie zurückkehren, nachdem die Entwicklung des menschlichen Denkens von Kopernikus zu Einstein geführt hat; aber dazu brauchte es 250 Jahre.
Ich glaube nicht, daß die allgemeine marxistische Kritik am kapitalistischen System obsolet werden kann, solange wir dies System — wie immer weiterentwickelt — haben. Unser Überdruß an einigen bekannten Formeln und Binsenwahrheiten des Marxismus läßt sie nicht falsch oder nutzlos werden. Einige Leute glauben, man müsse nur auf den jungen Marx zurückgreifen, seine frühesten und sogar seine unreifen Gedanken über »Verdinglichung« und Entfremdung in und außerhalb ihres Zusammenhangs zu deklamieren, sie in Zirkeln zu wiederholen, um die Probleme unseres Zeitalters zu lösen. Aber sie gehen nicht über den Marxismus hinaus, sondern vom reifen zum unreifen, jugendlichen Marx zurück. Aber selbst der junge Marx war ein reifer Denker im Vergleich zu jenen, die jetzt, wie es ein Sprecher formulierte, eine Tendenz zur infantilen Regression zur Schau stellen. Ich sehe nur eine wichtige marxistische Prognose, die durch die reale Entwicklung bisher in gewissem Maße widerlegt worden ist: Der Sozialismus hat bisher nicht in einer der fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften gesiegt, sondern in den zurückgebliebenen, wo eine feudale Struktur unter dem Einfluß des Kapitalismus zusammenbrach und wo feudal-kapitalistische Systeme unter dem Druck primitiver bürgerlicher und sozialistischer Revolutionen zusammenbrachen.
Als Erbschaft dieser geschichtlichen Entwicklung, die sich wirklich von der marxistischen Prognose unterscheidet, haben wir heute die mächtige Diskrepanz, die Kluft zwischen Ost und West, eine Kluft, die unglücklicherweise dazu tendiert, sich zum Schaden von Ost und West zu perpetuieren. Für Marxisten und Sozialisten, hier und anderswo, liegt das große Problem unseres Zeitalters, das Problem der Bewegung auf unser Ziel — den sozialistischen Menschen, eine sozialistische Gesellschaft — hin darin, wie diese Kluft zwischen den auseinanderweisenden geschichtlichen Wegen, die Ost und West eingeschlagen haben, sich überwinden läßt. Das ist das wirkliche Problem, vor der man sich nicht zu irgendwelchen Utopien der »befreienden« Drogen flüchten kann.
Ich wünschte, ich könnte die Begeisterung des Genossen auf der rechten Seite des Saales teilen, weil ich den großen revolutionären Idealismus und die internationale Bedeutung bestimmter revolutionärer Neuerungen, die die Chinesen vorgenommen haben, sehe. Unglücklicherweise wird uns solche souveräne, idealistische Verachtung der Realität der materiellen Lage Chinas nichts nützen, die Mißachtung der industriellen und kulturellen Rückständigkeit einer Gesellschaft, die den Heroismus aufbrachte, inmitten von Armut und Rückständigkeit eine sozialistische Revolution zu machen. Diese Bedingungen üben unglücklicherweise ihren Einfluß auf die Politik der chinesischen Regierung aus und bringen die Roten Garden dazu, nicht nur Rußlands sogenannten »Revisionismus« sondern auch Beethoven und Shakespeare als nutzlosen Unsinn einer degenerierten Bourgeois-Kultur zu verwerfen. Das kann ich nicht als Sozialismus anerkennen. Ich kann es nicht als eine befreiende Erfahrung akzeptieren. Ich kann auch den Mao-Kult um nichts besser als den Stalin-Kult finden, obwohl er in manchem entschuldbarer ist.
All diese Entwicklungen vertiefen die tragische Kluft zwischen den fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften des Westens und ihrer Arbeiterklassen auf der einen und den nachkapitalistischen revolutionären Gesellschaften des Ostens auf der andern Seite. Es fällt einem dabei das historische Beispiel des Abgrunds ein, der sich während der Religionskriege zwischen katholischen und protestantischen Ländern auftat. Auch der Protestantismus begann als eine Befreiungsbewegung, als Protest gegen die Unterdrückung durch die katholische Kirche. Dann aber entwickelte auch der Protestantismus im Laufe der Auseinandersetzung seine unterdrückenden Züge. Nach Jahrzehnten und Jahrhunderten des Kampfes stabilisierte sich die Situation, und die Trennungslinie zwischen katholischen und protestantischen Ländern war nicht mehr auszulöschen. Die historische Koexistenz zweier rivalisierender religiöser Bekenntnisse, hinter denen mächtige soziale Bewegungen standen, war eine Tatsache geworden. Etwas ähnliches hat sich zu unseren Lebzeiten ereignet: wir sind Zeugen der aktuellen Koexistenz — einer antagonistischen, feindlichen Koexistenz — zweier relativ stabiler Systeme geworden: des westlichen kapitalistisch-imperialistischen Systems und des nachkapitalistisch halbsozialistischen des Ostens. Ich denke aber, daß diese historische Analogie wenigstens in einem Punkt irreführend ist. Protestantismus und Katholizismus konnten auf lange Sicht koexistieren. Die Welt der Zeit nach den Religionskriegen, des 17. und 18. Jahrhunderts, war noch nicht eine Welt, noch nicht durch Technologie und Industrie geeint. Es war eine in viele Einheiten junger Nationalstaaten feudaler und halbfeudaler Fürstentümer fragmentierte Welt.
Die Welt von heute ist nach Möglichkeit und Wirklichkeit eine Welt; die Entwicklung der Produktivkräfte läßt die Menschheit zu einer unlösbaren Einheit werden, die nach Integration verlangt. Entweder wird die Menschheit sozialistisch integriert oder sie wird unterge-hen. Daher ist eine Stabilisierung der Trennungslinien, wie sie nach den Religionskriegen bestand, heute unmöglich geworden. Die Welt wird und muß eine werden. Und nur der Sozialismus kann sie einigen. Der Kapitalismus kann sie nur auseinanderreißen und ins Verderben führen. Aber die Frage ist: welcher Weg führt zu dieser Vereinigung der Welt?
Marx sprach von der Geschichte der Menschheit als einer Geschichte von Klassenkämpfen. Aber es war natürlich nicht so, daß der Klassenkampf in der gesamten Geschichte, in allen Jahrhunderten und in der ganzen Welt mit gleicher Intensität ausgetragen wurde. Wie wir wissen, ist der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus eine Sache vieler Generationen. Ich fühle mich dadurch, daß sich der Klassenkampf in unserer westlichen Gesellschaft auf so niedriger Ebene abgespielt hat, nicht so entmutigt, daß ich die marxistische Analyse und Prognose aufgebe. Es ist natürlich wahr, daß unsere arbeitenden Klassen, vor allem die älteren Jahrgänge, sich von den verführerischen Vorteilen unseres sogenannten Wohlfahrtsstaates haben verwirren, demoralisieren und korrumpieren lassen. Aber ich denke, daß das Problem, das der späte C. W. Mills stellte, wer Triebkraft des Sozialismus ist, die Arbeiterklasse oder intellektuelle Eliten, besonders in Amerika eine gründliche Diskussion und gründliche Analyse verlangt, da es sich nirgendwo mit gleicher Schärfe stellt.
Vor 60 Jahren sagte ein großer russischer Marxist, Leo Trotzki, Westeuropa habe seine beiden Hauptprodukte in verschiedener Richtung exportiert: seine fortgeschrittenste Theorie, den Marxismus, nach Rußland, seine fortgeschrittenste Technologie in die Vereinigten Staaten. Aber das Rußland, das den Marxismus als Import aus Westeuropa erhielt, war technisch und industriell zurückgeblieben, die rückständigste unter den großen europäischen Nationen. Die technisch so weit entwickelten Vereinigten Staaten sind leider im politischen Denken zurückgeblieben; sie sind bis heute — ich bedaure, das sagen zu müssen — ein im politischen Denken höchst unterentwickeltes Land geblieben. Ich glaube, daß die großen TeachIn-Bewegungen dieser beiden letzten Jahre und Versammlungen wie diese hier beweisen, daß die Vereinigten Staaten ansetzen zum Versuch, ihre Rückständigkeit in Fragen des gesellschaftstheoretischen und politischen Denkens abzuschütteln. Aber wie viel bleibt da noch abzuschütteln.
Ich halte es für eine große Schwäche dieser Bewegung, daß hier eine solche Konferenz abgehalten wird, ohne daß die Arbeiterklasse irgendein Interesse daran nimmt. Und Ihr solltet Euch nicht darüber beklagen — Ihr habt kein Recht dazu —,weil so viele von Euch amerikamischen Sozialisten (ich möchte nicht verallgemeinern) kein Interesse für Eure arbeitenden Klassen zeigen. Ich neige nicht dazu, Protestbewegungen, die in der Intelligentsia entstehen, abzuwerten. Ich denke immer daran, daß im 19. Jahrhundert die russische Intelligenz die entsetzliche Last des Kampfes gegen die russische Autokratie auf ihren schwachen Schultern trug, die ganze furchtbare Bürde der russischen Revolution. Im 19. Jahrhundert zerschmetterten sich Generationen von russischen Intellektuellen in heroischer Selbstaufopferung den Kopf an den Eisenwällen der russischen Autokratie und gingen unter. Aber sie opferten sich nicht umsonst. Sie arbeiteten für die Zukunft. Auch Ihr arbeitet für die Zukunft und für den sozialistischen Menschen. Die russische Intelligentsia des 19. Jahrhunderts war außerordentlich isoliert — die Bauernschaft reagierte nicht auf sie und die industrielle Arbeiterklasse war noch nicht entstanden. Da sie allein kämpften, entwickelten sie eine gewisse Selbstüberschätzung; das große Epos des revolutionären Kampfes im Rußland des 19. Jahrhunderts ist voll pathetischer, exzentrischer
Episoden, denn Intellektuelle, die keinen lebendigen Kontakt zu den arbeitenden Massen ihres Landes finden, neigen dazu, sich in exzentrischer Weise auf sich selbst zu konzentrieren und die fantastischsten Wundermittel für die Gesellschaft auszudenken.
Unsere Diskussion hat ähnliche Schwächen der Intellektuellen im heutigen Amerika enthüllt. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich von meinem Thema, dem sozialistischen Menschen, abgehe, aber wir müssen über den Menschen diskutieren, der dem sozialistischen Menschen den Weg bereiten muß, und das seid Ihr. Ich bin davon überzeugt — und das ist nicht dogmatische Glaubensangelegenheit, sondern Produkt der marxistischen Gesellschaftsanalyse —, daß Eure Arbeiterklasse die entscheidende Triebkraft des Sozialismus bleibt, so wie sich die russische Arbeiterklasse als entscheidende Triebfeder des Sozialismus erwiesen hat, nachdem Generationen von Intellektuellen allein gekämpft hatten.
Auch Ihr mögt allein kämpfen. Es hängt von Euch ab, wie lange. Vielleicht nur für ein paar Jahre, wenn Ihr einen Weg zu Eurer Arbeiterklasse findet. Oder jahrzehntelang, wenn Ihr versucht, die Arbeiterklasse zu ignorieren. Ihr werdet Euch die Köpfe an — der Himmel weiß wie vielen — eisernen Wällen einrennen, falls Ihr Eure Arbeiterklasse ignoriert. Denn jede Protest- und Oppositionsbewegung gegen die mächtigen kapitalistischen Oligarchien wird sich auf lange Sicht als ohnmächtig erweisen, sofern sie nicht den nationalen Produktionsapparat fest in die Hand bekommt.
Es ist richtig, daß Eure Wissenschaftler heute den Produktionsapparat des Landes viel fester im Griff haben als in irgendeiner früheren Generation. Aber — was immer über Kybernetik und die große Vision einer super-kybernetischen Zukunft gesagt wird — die große Masse der Produzenten in dieser Gesellschaft stellen noch immer die Arbeiter. Und ich glaube nicht, daß sie viel mehr Grund haben, mit dieser Gesellschaft, mit ihrer entfremdeten Lebenssituation zufrieden zu sein, als die Intelligentsia, als Ihr jungen amerikanischen Sozialisten. Habt Ihr wirklich eine so geringe Meinung von Eurer Arbeiterklasse, daß Ihr meint, nur Ihr wäret sensibel und vornehm genug, mit dieser entwürdigenden Gesellschaft unzufrieden zu sein? Glaubt Ihr nicht, daß auch sie von sich aus Unzufriedenheit entwickeln können? Glaubt Ihr wirklich, sie sei von Natur her so viel leichter korrumpierbar durch die lockenden Vorteile dieses Kriegskapitalismus als Ihr?
Ich weiß, daß die älteren Altersgruppen der amerikanischen Arbeiterklasse fast völlig korrumpiert sind. Sie vergleichen ihre jetzige Lage mit dem, was sie in den dreißiger Jahren erlebt haben. Aber der Kopf des jungen amerikanischen Arbeiters ist sicher nicht durch die Tatsache verdreht, daß im elterlichen Hause ein Fernsehgerät steht und daß er sich ein Auto leisten kann. Er hält diese Dinge für selbstverständlich. Sie sind Teil des Lebensstandards, den er beim Erwachsenwerden vorfindet. Dadurch wird er sicherlich nicht korrumpiert, und er hat genug Verstand, um unzufrieden zu sein. Ich bin sicher, daß hinter seiner äußerlichen politischen Apathie viele Schichten von Zweifel und Unzufriedenheit liegen und ein Gefühl dafür, daß er seinen Lebensunterhalt durch Arbeit für Krieg und Tod verdienen muß. Könnt Ihr nicht mit diesem jungen Arbeiter sprechen und ihm sagen, daß man nur leben kann, wenn man für das Leben und nicht für den Tod arbeitet? Ist es unter der Würde amerikanischer Studenten, so etwas zu versuchen? Professor Marcuse sagt uns, daß wir auf die Arbeiterklasse nicht mehr rechnen können, aber er sagt uns nicht, auf wen wir zählen sollen. Er meint, wir sollten auf die jungen Leute zählen, die ihr Unbehagen an den sexuellen Konventionen dieser Gesellschaft zum Ausdruck bringen. Natürlich sollten wir auch auf sie zählen. Schließlich hat Engels über die Ursprünge der Familie geschrieben und dargelegt, daß die Familie als Institution nur zu einer Fase oder zu bestimmten Fasen der gesellschaftlichen Entwicklung gehört; und er beschrieb die Konventionen der bürgerlichen Moral, die um die Familie herum aufgebaut worden sind. Wir sollten diese Unzufriedenheit mit der Familie und den sexuellen Konventionen bei der jungen Generation nicht ignorieren, aber manchmal habe ich den Eindruck, daß solche alten, verehrungswürdigen Lehrer wie Professor Marcuse sich einen Spaß mit uns erlauben, sich einfach auf unsere Kosten amüsieren. Zuerst sagt er, der Marxismus sei nicht utopisch genug gewesen; dann fährt er fort und sagt, die gegenwärtige Entwicklung zeige, daß die Vorstellung einer sozialistischen Revolution in den fortgeschrittenen Industriegesellschaften unrealistisch und
veraltet sei, ebenso wie die Idee einer schrittweisen Umformung des Kapitalismus zum Sozialismus. Ziehen wir Bilanz: Revolution und Reformismus sind veraltete Ideen. Also gibt es keinen Weg vom Kapitalismus zum Sozialismus, weder den revolutionären noch den reformistischen. Warum soll man dann überhaupt über Sozialismus reden? Professor Marcuse sagt uns, daß der Sozialismus utopisch war und daß er nicht genug utopisch war. Wie kann ein alter und geachteter Lehrer soviel Unlogisches von sich geben und mit so unverantwortlich vagen Allgemeinheiten herumspielen. Diese Diskussion war für mich in vieler Hinsicht eine traurige Erfahrung. Aber ich bleibe ein unverbesserlicher Optimist. Ich halte das für die Gestehungskosten eines schöpferischen intellektuellen Ferments. Ich wünsche Euch Klarheit und Ehrlichkeit im Denken und wünschte, Ihr würdet Euch auf das Wesentliche konzentrieren, statt Euch durch zirkusartige Unternehmungen abzulenken, die mit ernsthaftem politischen Denken nichts zu tun haben.
Ihr könnt der Politik nicht entfliehen. Menschen leben nicht von der Politik allein, das ist wahr. Aber wenn Ihr nicht die großen Probleme löst, die der Marxismus, die Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft, die Beziehungen zwischen Intellektuellen und Arbeitern in dieser Gesellschaft stellen, wenn Ihr nicht einen Weg zur jungen Generation der amerikanischen Arbeiterklasse findet und den schlafenden Riesen der amerikanischen Arbeiterklasse aufweckt, ihn seinem Schlaf und seinem Opium entreißt, seid Ihr verloren. Eure einzige Rettung ist es, die Idee des Sozialismus wieder in die Arbeiterklasse hineinzutragen, und dann gemeinsam mit der Arbeiterklasse die kapitalistischen Bastionen zu stürmen. —