Politische Charaktermasken
Politische Charaktermasken
Die Öffentlichkeit neigt allenthalben dazu, die Politik so zu personalisieren, daß der Staat und dessen Räson einer Beleuchtung gar nicht erst anheimfällt. Dabei machen sich die Politiker an den Prämissen, die der Staat als solcher vorgibt, zu schaffen, sie wollen sie zum Wohle der Nation per (schier uferlosen) Erweiterung des Rechts, der Legitimierung der Gewalt, vorantreiben. Für die Medien dreht sich also alles um den (Miß)Erfolg des Personals an den unterstellten, vorgegebenen Staatsaufgaben. Die regelmäßigen Umfragen bezüglich der Beliebtheit von Politikern sagen da schon alles über den allgemeinen politischen Geisteszustand einer Republik aus.
US-Präsident Trump, wie man so schön sagt, »kommt aus der Wirtschaft«. Das ist heutzutage nichts Besonderes, fast überall in den führenden westlichen Demokratien, versuchen Magnaten des Kapitals auch in der Politik erfolgreich zu sein. Sie wissen um die Abhängigkeit des Kapitals vom Staat. Nur allzu oft stöhnen sie über die Maßregelungen des Klassenstaats, seine Beschränkungen empfinden sie als Zumutung, denn schließlich sind sie es ja, die mit ihren nicht selten riskanten Investitionen für den nationalen Reichtum — den abstrakten, in Geld gemessenen — sorgen. Solch ein Wirtschaftskapitän denkt nur allzu gern darüber nach, wie insbesondere Wirtschaftspolitik besser ginge. Und er neigt dazu, selber besser Politik machen zu können als die augenblicklichen Amtsinhaber.
Vor allem in den USA ist das durchaus eine große Herausforderung, Als Staat mit dem weltweit größten Inlandsprodukt und der Weltreservewährung verfügen die USA über die ökonomischen Mittel, ihre Vormachtstellung gezielt zum eigenen Vorteil einzusetzen: Die Wirtschaft als Quidproquo aller Politik. Dem hat kein Staat — das aufstrebende China ausgenommen — etwas entgegenzusetzen. Dies erlaubt einem Staatsführer allenthalben über die Gründe einer Wirtschaftskrise — vor der auch die Weltmacht Nr. 1 nicht gefeit ist — hinwegzusehen. Stattdessen beschuldigt — im aktuellen Fall — Präsident Trump andere Staaten, unfaire Handelspraktiken gegenüber den USA anzuwenden, die zu dem vorliegenden Zahlungsbilanzdefizit und einer hohen Staatsverschuldung geführt hätten. Daraus folgt zum einen mittels Steuersenkungen das eigene nationale Kapital in eine verbesserte Konkurrenzsituation zu versetzen; zum anderen gegenüber anderen Staaten Zölle als passable Waffe zu erachten, eben zum Schaden derer Wirtschaft. So andere Staaten das nicht auf sich sitzen lassen können — und welcher kann das schon? —, taugt diese Waffe zu Handelsabkommen, die für die USA vorteilhafter ausfallen als bisherige. Daß US-Finanzminister Scott Bessent — auch er kommt selbstverständlich aus der Wirtschaft — die von den erpreßten Partnern zugesagten Investitionen gleich ins Verhältnis zur US-Staatsverschuldung setzt, zeigt, daß man auch als Politiker genau so spekulativ denken kann wie als ganz gemeiner Kapitaleigner oder -manager.
Nun ist Finanz- und Wirtschaftspolitik nicht alles, was den Wirtschaftsstandort, den Staat ausmacht. Schließlich handelt es sich beim Staat um ein Gewaltmonopol, das zum Einsatz kommt, wo ökonomische Maßnahmen nicht ausreichen. Das gilt erst einmal im Lande selber. Dort existieren tatsächlich Leute, die nichts zum Erfolg der Nation beitragen. Dies erscheint einem, der als Wirtschaftsführer schon so viel geleistet hat, geradezu als eine Unverschämtheit. Und deshalb schaut er genauer hin: Er stellt fest, daß es sich zu einem großen Teil um Ausländer handelt, die sich schmarotzender- und verbrecherischerweise im Lande eingenistet haben. Als Politiker sieht er es also als vordringlich an, diesen unökonomischen Ballast wieder loszuwerden und erst recht keinen neuen Ballast dieser Sorte hereinzulassen. Aber auch die untätigen Inländer, die als Obdachlose die amerikanischen Großstädte beleben, sind einem verantwortungsvollen Politiker ein Dorn im Auge. Er läßt die Nationalgarde aufziehen, um zumindest die Innenstädte als Flanier- und Verkaufsmeilen wieder attraktiv zu machen. Vor allem in der international repräsentativen Hauptstadt Washington scheint das ja besonders vordringlich gewesen zu sein.
 So manches Ausland allerdings fällt einem Präsidenten nicht weniger unangenehm ins Auge. Da gibt es doch tatsächlich Staaten, die nicht nach der Pfeife des USA tanzen. Deren Staatsführer widersetzen sich allen Vorschlägen, zugunsten der von den USA protegierten, somit einzig demokratischen Opposition abzutreten. Dabei meinen es die USA ja nur gut: Welch supertolle Wirtschaftsbeziehungen stellen die USA auch solchen Staaten in Aussicht. Die USA wissen doch sehr gut, daß es doch auch anders geht: Gerade in Europa bemühen sich doch fast alle, — um es einmal salopp auszudrücken — einen Wohlfühlplatz im Arsch der USA zu finden, der einzige wirkliche Platz an der Sonne. Es ist also sehr frustrierend, wenn ein verantwortungsvoller Staatsmann zum letzten Mittel greifen, sein Militär auffahren lassen muß. Allerdings ist es noch frustrierender, wenn selbst Luftschläge nicht auf Verständnis stoßen, sondern in jenen Staaten eine Verhärtung ihrer Haltung hervorrufen. Nun hat der Präsident schon in seiner ersten Amtszeit ein erstes Exempel mit einem massiven Luftschlag gegen Syrien (am 07.04.'17 mit 59 Tomahawk Cruise Missiles) gezeigt. Auch wenn der Erfolg nicht unmittelbar eintrat, so konnte der US-Präsident in seiner zweiten Amtszeit den Erfolg begrüßen, in Person von al-Julani, den vormals als Terrorist gesuchten Führer von al-Qaida-Ableger Hayat Tahrir al-Sham (HTS), nun Präsident Syriens, welchem Trump die Ehre erwies, ihn im Weißen Haus zu empfangen.
So manches Ausland allerdings fällt einem Präsidenten nicht weniger unangenehm ins Auge. Da gibt es doch tatsächlich Staaten, die nicht nach der Pfeife des USA tanzen. Deren Staatsführer widersetzen sich allen Vorschlägen, zugunsten der von den USA protegierten, somit einzig demokratischen Opposition abzutreten. Dabei meinen es die USA ja nur gut: Welch supertolle Wirtschaftsbeziehungen stellen die USA auch solchen Staaten in Aussicht. Die USA wissen doch sehr gut, daß es doch auch anders geht: Gerade in Europa bemühen sich doch fast alle, — um es einmal salopp auszudrücken — einen Wohlfühlplatz im Arsch der USA zu finden, der einzige wirkliche Platz an der Sonne. Es ist also sehr frustrierend, wenn ein verantwortungsvoller Staatsmann zum letzten Mittel greifen, sein Militär auffahren lassen muß. Allerdings ist es noch frustrierender, wenn selbst Luftschläge nicht auf Verständnis stoßen, sondern in jenen Staaten eine Verhärtung ihrer Haltung hervorrufen. Nun hat der Präsident schon in seiner ersten Amtszeit ein erstes Exempel mit einem massiven Luftschlag gegen Syrien (am 07.04.'17 mit 59 Tomahawk Cruise Missiles) gezeigt. Auch wenn der Erfolg nicht unmittelbar eintrat, so konnte der US-Präsident in seiner zweiten Amtszeit den Erfolg begrüßen, in Person von al-Julani, den vormals als Terrorist gesuchten Führer von al-Qaida-Ableger Hayat Tahrir al-Sham (HTS), nun Präsident Syriens, welchem Trump die Ehre erwies, ihn im Weißen Haus zu empfangen.
Dieses Erfolgsrezept sieht sich der Präsident gezwungen, auch in seiner zweiten Amtszeit anzuwenden: Die Luftschläge gegen den Jemen und den Iran haben demonstriert, zu welchen Schäden der dort ansässigen Bevölkerung eine falsche Herrschaft gereicht. [Bei einer Ehrung beteiligter Militärs (am 29.22.'25) rühmte sich Trump, obschon der Schlag gegen den Iran seit 22 Jahren vorbereitet worden war, habe er ihn endlich ausführen lassen.] Noch freilich haben es weder die Huthis noch die Perser verstanden. So stellt sich die Frage, ob die USA da noch nachlegen müssen. Im Irak hat ja seinerzeit der Sohn George W. Bush das nachgeholt, was sein Vater George H.W. Bush als Präsident noch offen gelassen hat: Nämlich den Wechsel an der Staatsführung und damit in der Staatsräson des Irak zu erreichen. Die damalige Begründung des Krieges, es handele sich um einen Staat mit Massenvernichtungswaffen, die einem so unzuverlässigen nicht zustehen, flog erst dann in vollem medialen Umfang als Lüge auf, als der Erfolg schon sichergestellt war.
Einen Wechsel in der Staatsführung zugunsten der USA fordern diese seit langem auch in Venezuela. Die Sanktionen gegen diesen Staat — Trump hatte 2017 die staatliche Erdölgesellschaft Petróleos de Venezuela S.A. sanktioniert — haben noch nicht zu einem Erfolg geführt, was doppelt ärgerlich ist, weil Venezuela den USA das — so sehen sie es — hauptsächlich ihnen zustehende Erdöl verweigern und damit auch für die als für zu hoch empfundenen Energiekosten verantwortlich sind. Auch wenn die Regierung in Caracas über Handelsfragen nach eigenem Bekunden mit sich reden läßt, soll sich der Erfolg endlich viel grundsätzlicher und gründlicher einstellen. Doch wer glaubt, die USA befänden sich darüber in einer Verlegenheit, täuscht sich. Was liegt näher, als einem südamerikanischen Staat vorzuwerfen, die USA mit Drogen destabilisieren zu wollen? Und so ließ Trump seine Armada vor Venezuela aufkreuzen. Und sie hat sogleich einige mutmaßliche Drogenboote versenkt, so daß der Präsident einen Rückgang des Drogenimports über die Karibik von 85% konstatieren konnte (am 28.11.'25) — wahrscheinlich hat er einfach die Zahl der dabei Getöteten, die sich auf ungefähr 85 belief, dafür hergenommen. Damit ist er freilich nicht zufrieden. Ein ökonomisch Denkender macht ja nichts unter 100%, bevor er seine Mission als erfüllt ansieht. Das bedeutet, daß die Armada noch ein ganzes Weilchen vor Venezuela bleiben muß. Solange jedenfalls, bis die CIA, die den Befehl erhalten hat, im Feindeslande selbst nach Zielen zu suchen, Bescheid geben kann, was wiederum heißt, daß dann ein Befehl zum Einsatz der Streitkräfte erfolgen kann. Es sei denn, Präsident Maduro überlegt sich das noch einmal anders und tritt ab. Er hat also noch eine Galgenfrist (Stand: 30.11.'25). Allerdings ist die auch noch durch einen anderen unglücklichen Umstand bedingt. Kaum jemand — weder in den USA noch sonstwo auf der Welt — nimmt der US-Regierung die Lüge ab, es handle sich bei Venezuela um einen Drogenhändlerstaat. Doch auch da setzen die USA alles auf eine Karte. Und die hieß in diesem Falle »Friedensnobelpreis«. Mit dieser carte blanche wurde bekanntlich eine venezuelanische US-Vasallin beglückt. Da konnten die staatshörigen Medien des freien Westens kaum umhin, dies zu begrüßen. Der US-Aufmarsch gilt nun als legitime Bekräftigung einer Kriegsnobelpreisträgerin (angepaßte Bezeichnung à la »Kriegsministerium«). Wie Venezuela so haben die USA mit Nigeria ein weiteres wichtiges Ölförderland ins Visier genommen und zwar unter der verlogenen Anschuldigung, die dortige Regierung würde die christliche Bevölkerung gegen terroristische Übergriffe der islamischen Fundamentalistenmiliz Boko Haram nicht zu schützen wissen.
Im übrigen weist auch der Ukraine-Krieg darauf hin, daß die USA alle Gewalt unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachten: Der Vorwurf, dieser Krieg sei allein der Vorgängerregierung unter Biden geschuldet, heißt ja im Klartext: Alle Mittel für diesen Krieg seien umsonst aufgewandt worden, da sich der Erfolg nicht eingestellt hat. So etwas kann selbstverständlich einem Trump nicht passieren! Das ist ihm Grund genug, sich dieses Krieges entledigen zu wollen. Den hatte er in seiner ersten Amtsperiode mit einer drastischen Aufrüstung des antirussischen Vasallenstaates eingeleitet.
Kleiner Zusatz:
Eine Meinung, die man immer wieder hört, ist, Trump sei ein Faschist. Auch der sich selbst als »demokratischer Sozialist« bezeichnende, frisch gewählte Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani nannte ihn so. An dieser Stelle sei ein Vergleich erlaubt: Wie gesagt, Trump kommt aus der Wirtschaft, ein gemachter Mann mit viel Geld. Hitler hingegen entstammte dem Subproletariat; aus purer Not verpflichtete er sich bei der Wehrmacht und entwickelte ein positives, völlig unökonomisches Verhältnis zur staatlichen Gewalt. Deshalb setzte er sich, als er Kanzler geworden war, auch vorsätzlich über alle ökonomischen Belange hinweg und schlug ganz unmittelbar den Weg der Gewalt ein. Im weiteren Verlauf seiner Politik verfolgte er diesen umso intensiver, je weniger der ökonomisch rationell war. Viel eher als Trump haben sich in dieser Hinsicht Bundeskanzler Merz, der bekanntlich ja auch aus der Wirtschaft kommt, und sein Vorgänger Scholz auf diesen Pfad begeben. [Das soll jetzt nicht heißen, ein Reicher könne kein Faschist werden und ein Elender wäre prädestiniert, Faschist zu werden.]
30.11.2025 © Kommunikation & Kaffee Augsburg
www.koka-augsburg.net:
Feedback: info@koka-augsburg.com
Finanzimperialismus — Die USA und ihre Strategie
Weltgeld: Der Widerspruch einer gewaltsam durchgesetzten nationalen Ökonomie
Finanzimperialismus — Die USA und ihre Strategie des globalen Kapitalismus
Die Dedollarisierung, die voranschreitet und welche die Mainstreammedien vergeblich in den Hintergrund zu drücken, herunterzuspielen versuchen, macht den Widerspruch deutlich zwischen einem nationalen Geld, einer Währung, die gleichzeitig eine internationale Währung ist, also Weltgeld. Diesen Anspruch, Weltgeld zu sein, konnte die USA in Folge des 2. Weltkriegs durchsetzen und mit ihrer überlegenen Militärmacht, die dafür weltweit auf- und ausgebaut wurde, etablieren und bis heute erhalten. Wenn heute diese dominante Stellung des US-Dollars in Frage gestellt ist, ist es durchaus wichtig zu wissen, wie es dazu kommen konnte. Und vor allem, welche Vorteile dem us-amerikanischen Staat erwachsen waren, die er heute unter Führung von Präsident Trump zu verteidigen beabsichtigt, mit Zöllen, mit Sanktionen, mit neuen Kriegen, mannigfarbigen Regierungsumstürzen sowie milliardenschwerem Durchfüttern von Vasallenregierungen (wie zuletzt in Argentinien). Es versteht sich von selber, daß diese Anfechtung der US-Dominanz von Staaten und deren Bevölkerung kommt, die unter dem US-Imperialismus gelitten haben und dieser Misere überdrüssig geworden sind. So ist auch der Aufstieg des BRICS-Blocks zu verstehen, dessen Mitglieder angetreten sind, die US-Währung konsequent aus dem Welthandel zurückzudrängen.
Michael Hudson, unter anderem Professor für politische Ökonomie in den USA, hat die Geschichte des US-Finanzimperialismus aufgeschrieben und erläutert, aufgrund welcher Ansprüche und mit welchen Berechnungen die USA den dafür anfallenden Notwendigkeiten entsprachen.
Die einzelnen Kapitel:
1. Ursprünge der zwischenstaatlichen Schulden (1917-1921)
2. Der Zusammenbruch des globalen Gleichgewichts (1921-1933)
3. Die Vereinigten Staaten verschmähen die globale Führungsrolle
4. Das Leih-Pacht-System und der Zerfall des britischen Weltreichs (1941-1945)
5. Bretton Woods: Der Triumf des staatlichen amerikanischen Finanzkapitals
6. Der kommunistische Block wird isoliert
7. Die amerikanische Strategie in der Weltbank
8. Der Imperialismus der US-Auslandshilfe
9. GATT und der doppelte Standard
10. Die Vorherrschaft des Dollars durch den IWF (1945-1946)
11. Wie Amerika seine Kriege mit den Finanzmitteln anderer Staaten finanzierte (1964-1968)
12. Macht durch Bankrott (1968-1970)
13. Das Imperium durch eine Währungskrise vervollkommnen (1970-1972)
14. Die monetäre Frühjahrsoffensive von 1973
16.11.2025
© Kommunikation & Kaffee Augsburg
www.koka-augsburg.net:
Feedback: info@koka-augsburg.com
Der Chip-Krieg des US-Imperialismus gegen China
Den EU-Staaten fehlen die Erpressungsmittel im
im Chip-Krieg des US-Imperialismus gegen China
Nexperia, einst zum niederländischen Philips-Konzern gehörig, wurde durch chinesische Investitionen wiederbelebt. Die chinesische Firma Wing Technology übernahm die Firma 2019. Die EU¹ brauchte dringend diesen Halbleiterhersteller, um in der internationalen Konkurrenz mithalten zu können. China sah die Chance — und hatte auch das Kapital —, um in den Niederlanden und damit in der EU einsteigen zu können. Doch dann sahen sich auf einmal die USA von China bedroht, sie glaubten Europa an die chinesische Konkurrenz zu verlieren. Sie setzten die Niederlande unter Druck. Die niederländische Firma ASML, Produzent von zur Chipherstellung nötigen Gerätschaften, sollte ihre Exportprivilegien verlieren und damit ihren Profit riskieren, sollte Amsterdam/Den Haag nicht einlenken. Die niederländische Regierung stellte daraufhin Untersuchungen an, die Anfang des Jahres 2024 dazu führten, Nexperia Expansionspläne zu untersagen und mit einer Zerlegung der Firma zu drohen. Man war zu der Ansicht gelangt, die Chips der Firma würden als Batterien für Elektrofahrzeuge und als Bestandteile militärischer Geräte wie Radaranlagen genutzt. Sie würden also ein nationales Sicherheitsrisiko darstellen. Beijing sah das als Kniefall vor Washington.
Im Jahre 2022 sah Großbritannien ähnliche Sicherheitsbedenken. Nexperia wurde gezwungen, seine Halbleiterscheiben produzierende Fabrik in Newport zu verkaufen.
Nun, 2025 hatten die USA nochmal ihren Druck erhöht. Die Niederlande enteigneten Nexperia. Das wiederum ließ sich China nicht bieten. Es erließ Exportbeschränkungen für Materialien, die zur Herstellung von Halbleitern nötig sind, für die »seltenen Erden« Germanium und Gallium. Dies betraf damit nicht allein Nexperia, sondern alle auf diese Materialien angewiesenen Industrien. Darüber hinaus reduzierten chinesische Banken ihr Investment in europäische Hightech-Firmen und leiteten diese in Länder Asiens um. Die Firma ASML (Advanced Semiconductor Materials Lithography) wurde der Heuchelei überführt, denn sie habe jahrelang vom chinesischen Markt profitiert, hintergehe jetzt aber ihre Kunden auf US-Befehl. Etwa 15% des Profits erwirtschaftete ASML mit chinesischen Firmen, u.a. mit Nexperia. Außerdem lud China französische und deutsche Handelsvertretungen ein — mit einem deutlichen Fingerzeigen auf die Niederlande: Wer sich nicht einem Diktat aus Washington folgt, dem stehen die Geschäftstüren mit China offen.
ASML ist in der Tat noch mehr umstritten als Nexperia. Schon unter Donald dem Ersten, im Jahre 2019 wurden die Niederlande unter Druck gesetzt, Exporte ihrer mittels EUV-Lithografie hergestellten Anlagen — hier hatte (und hat noch weitgehend) die Firma ein weltweites Monopol! — nach China zu unterbinden. Die USA selber blockierten eine Schlüssellizenz für den Export in die chinesische Halbleiter-Gießerei SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Unter Biden gingen die USA dann noch weiter und drängten auf die Begrenzung von DUV-Maschinen, ältere Lithografie-Modelle, die in China aber nach wie vor große Verwendung zur Chipherstellung fanden. 2024 stimmten die Niederlande stärkeren Exportkontrollen zu: ASML durfte keine in China tätigen Maschinen mehr warten oder upgraden. Das konnte sich China natürlich nicht bieten lassen. Bestellungen aus China wurden eingestellt und damit vor allem längerfristig der Profit der Firma bedroht. Außerdem rüstete China auf. China sponserte die eigenen Firmen Highon (eine von 5 Halbleiterprojektfirmen von Huawei) und SME (Shanghai Micro Electronics Equipment).
Am 7. November nun hat die niederländische Regierung sich bereit erklärt, ihre Kontrolle über Nexperia wieder fallen zu lassen, wenn zugleich die nötigen Materiallieferungen wieder aufgenommen werden würden. Nicht nur den Arbeiter in den Firmensitzen in Nijmegen und Eindhoven bleiben somit ganz ohne Einschreiten der Gewerkschaften die Arbeitsplätze erhalten, auch all denen, deren Firmen auf die Chips angewiesen sind, unter anderem die deutsche Ausbeuterfirma Nr. 1, VW.
Das Handelsblatt beurteilt die Lage so, den deutschen Weltmachtanspruch als EU-Räson einfordernd:
»1. China ist nicht zu trauen – Amerika auch nicht Es ist fahrlässig, sich weiterhin auf Lieferungen aus China zu verlassen. Die Volksrepublik instrumentalisiert Halbleiter, um die eigenen Interessen durchzusetzen, und zwar ohne zu zögern.
Allerdings stehen die USA den Chinesen in nichts nach. So hat Washington den Export bestimmter Halbleiter nach China untersagt. Die Regierung von Ex-Präsident Joe Biden wollte einst sogar die Ausfuhr in westliche Länder beschränken. Auf die Großmächte ist kein Verlaß, wenn es um die strategisch wichtigen Halbleiter geht. Europa benötigt dringend mehr Erpressungspotenzial.
2. Erst nachdenken, dann handeln Die niederländische Regierung hat über Nacht dem chinesischen Eigentümer Nexperia entzogen. Dafür gab es nachvollziehbare Gründe. Trotzdem wäre es klug gewesen, vorher über die Konsequenzen nachzudenken.
3. Europa fehlt es an Erpressungspotenzial Dem Lieferstop der Chinesen hatte Europa nichts entgegenzusetzen. Nur eine Technologie ist einzigartig auf dem Kontinent: das sogenannte EUV-Verfahren des Anlagenbauers ASML. Es ist zwingend nötig, um die fortschrittlichsten Chips zu fertigen. Im Fall von China hilft das nichts, weil ASML seine modernsten Maschinen ohnehin nicht in das Land exportieren darf. Europa benötigt dringend mehr Erpressungspotenzial.
4. Das Chipgesetz ist ein Rohrkrepierer Die EU-Kommission wollte mit einem Chipgesetz dafür sorgen, daß sich der Anteil Europas an der weltweiten Produktion bis zum Jahr 2030 auf 20 Prozent verdoppelt. Stand heute wird dieses Ziel klar verfehlt. Allerdings: Nur wenn Europa nennenswert selbst produziert, läßt sich Druck auf andere Länder ausüben.
5. Lieferengpässe mit Allianzen vermeiden Kurzfristig lassen sich neue Chipengpässe nur abwenden, indem die Firmen ihre Lieferantenbasis erweitern und die Politik Allianzen schließt. Und das mit Ländern, die ebenfalls von den Supermächten unter Druck gesetzt werden: Allen voran Japan, Taiwan und Südkorea für den Kern der Chipfertigung sowie Malaysia, Indonesien und die Philippinen fürs Verpacken und Testen. Ohne Produktionskapazitäten und technologisches Drohpotenzial bleibt Europa abhängig. Nur durch Investitionen und gezielte Bündnisse wird Europa weniger verletzlich.« (HB, 12.11.25)
1. Die Gleichsetzung von den USA mit China ist verlogen. Schließlich hat sich China nur den freien Welthandel zunutze gemacht, den die USA stets propagiert haben, von dem sie aber nichts mehr wissen wollen, wenn der zu ihren Ungunsten ausschlägt. China muß sich also mit Verhältnissen herumschlagen, die es nicht erfunden hat. Im Gegenteil, China hat ganz praktisch aufgezeigt, daß es beim Freihandel um eine Ideologie handelt, die nur einem Staat nützt, der mit überlegenen Mitteln produzieren kann. Gleichzeitig wird deutlich, daß die USA die ökonomische Weltordnung als eine einzig ihren Gewaltmitteln geschuldete betrachtet und sich deshalb Eingriffe in andere Staaten erlaubt, herausnehmen zu dürfen. Dieses Abheben auf militärische Gewalt ist China fremd. Allerdings betrachtet es den extremistischen us-amerikanischen Standpunkt als Bedrohung der eigenen Souveränität.
2. Europa denkt nicht nach: Wem sagt das HB-Männchen das? Ist ihm das auch eingefallen, als sich die EU und allen voran die BRD sich schließlich dem US-Diktat unterwarf und sich von den russischen Energielieferungen löste, das der Wirtschaft wie den Verbrauchern teuer zu stehen kommt?
3. Wenn Kapitalismus, dann auch gehöriges Erpressungspotenzial! Scheitert solch Potenzial lediglich an einer (US-hörigen?) EU-Bürokratie, die unrealistische Ziele gesetzlich fixiert? An den gewaltigen Ansprüchen liegt es ja wohl nicht!
4. In Sachen Ausbeutung ist das Handelsblatt unschlagbar: Es weiß genau, wo sich welche Ausbeutungsmodelle befinden, die sich die EU zunutze machen kann. Chips in Taiwan, hergestellt zu Billigsttarifen, Dienstleistungen dann in südostasiatischen Ländern, wo jeder froh sein kann, überhaupt eine Lohnarbeit zu finden… Die Arbeiter sollen auch dort für die imperialistische Konkurrenzfähigkeit des deutschen Staates und seines EU-Projekts bluten, was denn sonst!
___________________
¹ Die EU (damals noch EWG) wurde einst hauptsächlich von Deutschland und Frankreich, aber auch Italien sowie den Niederlanden ins Leben gerufen. Jeder dieser Staaten sah sich allein zu schwach, der damals unangefochten ökonomisch dominierenden USA Paroli bieten zu können. Gleichwohl hatten die Westeuropäer genau diesen Anspruch. Mit jeder Erweiterung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wurde jeder neue Mitgliedsstaat darauf verpflichtet, zur Wirtschaftskraft der zunehmend deutsch dominierten Gesamt-EU beizutragen. Sollte er dazu noch nicht fähig sein, verpflichtet er sich darauf, mit Hilfe der anderen Staaten seine Wirtschaft profitabel aus- und herzurichten. Diesem Anspruch unterwarfen sich zuletzt auch die ehemaligen RGW-Staaten und Teile Ex-Jugoslawiens.
13.11.2025
© Kommunikation & Kaffee Augsburg
www.koka-augsburg.net
Feedback: info@koka-augsburg.com
Die Kosten der Freiheit steigen rapide
Die USA zwischen Prinzipien und notwendig gewordenem Opportunismus — für die bombenfesten Europäer ein Skandal
Die Kosten der Freiheit steigen rapide
Die derzeit die USA regierende Partei der Republikaner war bis noch vor nicht allzu langer Zeit eine Partei, deren Staatsräson in möglichst wenig Staatseingriffen in die Wirtschaft und in einem harten Plädoyer für Freihandel bestand. Das hat sich mittlerweile unter der Führung des Präsidenten Trump umgekehrt. Nun gebietet ihnen die Staatsräson das glatte Gegenteil: Sie ist zum Protektionismus umgeschwenkt, weil ihre Wirtschaft in der internationalen Konkurrenz Federn hat lassen müssen. Die überbordende Rolle des Finanzkapitals kann nicht verhindern, daß die Warenproduktion und damit auch die Exporte schrumpfen. Kürzlich gab es in den städtischen Zentren der USA Großdemonstrationen vornehmlich gegen die Selbstherrlichkeit des »Diktators« Trump. Allein seiner Arroganz wurde attestiert, für die Folgen seiner Politik verantwortlich zu sein. Die resultiert in einer Geldentwertung einerseits bei vielfach gleichzeitig stattfindendem Einkommensausfall andrerseits. Es gelang der demonstrierenden Masse mühelos, diesen materiellen Grund in eine verfehlte Politik einer allzu dummen Charaktermaske zu übersetzen. Dabei wissen die Aktivisten selber nicht — und die oppositionelle Partei der Demokraten ebensowenig — wie denn eine »vernünftige Politik«, eine attraktive Charaktermaske stattdessen aussehen könnte.
Doch so ist es eben: Leute, die kein Geld mehr haben, können nichts mehr kaufen und so zieht das Land auch keine Geschäftemacher, pardon: Investoren mehr an, welche vorhandene Kaufkraft auf ihre Mühlen zu lenken versteht. Ja, die USA leben trotz aller wirtschaftlichen Misere auf großem Fuß, was ihrem Weltmachtstatus und ihrem -anspruch entspricht. Allein für die weltumspannenden Militärbasen und die auf die Weltmeere zu deren Überwachung beorderten Flugzeugträger geben sie Milliarden aus, ökonomisch gesehen völlig unproduktive Kosten. Das »Wirtschaftswunder« der BRD nach dem Krieg war dadurch begünstigt, daß der NS-Nachfolgestaat solche Ausgaben erst einmal nicht zu tragen hatte und sodann sie noch — vergleichsweise zu heute — moderat ausfielen. Wenn also Trump ein Wirtschaftswunder für die USA anstrebt, dann ist er sicher der letzte, der aus der Historie des eigenen oder eines anderen Staates Lehren zu ziehen gedenkt. Er interessiert sich in Sachen Geschichte allein für die fänomenalen Taten großer Staatsmänner. Sein überragendes Vorbild, in dessen Fußstapfen er schon alsbald zu treten gedachte, ist sein damaliger Parteifreund Ronald Reagan. Dieser hatte es vollbracht, die Sowjetunion zur Abdankung zu bewegen. Ähnliches wie Ronald wollte auch Donald vollbringen, als es den russischen Präsidenten nach Alaska eingeladen hatte: Jener sollte in Sachen Ukraine einen Rückzieher machen. Blöderweise ließ sich Putin nicht über den Tisch ziehen und so mißlang die Abwicklung des Konflikts im Sinne der USA. Vorteilhafterweise soll ja das Kapital nicht aus und in der Ukraine, sondern im eigenen Land Kapital schlagen. dazu kommt, daß der europäischen Konkurrenz ist die Ukraine als Kapitalanlagemöglichkeit entzogen ist — nicht zu reden vom Geschäftsausfall mit Rußland. Der EU halsen die USA die Kosten für einen fortgesetzten Krieg, was zwangsläufig zu einer weiteren Schädigung ihrer Ökonomie führen muß. Damit entledigen sich die USA der leidigen europäischen Konkurrenz, ohne das ausdrücklich in ihrem Programm zu haben. Der Krieg nützt den USA sogesehen durchaus. Freilich Geld für Investitionen in den USA hat das deutsche Kapital nicht übrig. Rätselhaft ist, wie die Präsidentin der EU-Kommission den USA Investitionen in Höhe von 600 Milliarden USD nebst 750 Milliarden USD für US-Energieträger in einem Abkommen mit Donald zusagen konnte. Herr Schäuble würde sich sicher im Grabe umdrehen, wenn er mitbekäme, was aus seiner »schwarzen Null« geworden ist. Nicht nur die US-Republikaner haben sich den Staatsnöten angepaßt, auch die europäischen Politiker. Und man mag sich streiten, wer die Ökonomie seines Staates nun besser managt.
Eines darf jedoch dabei nicht vergessen werden: Es sind ja nicht allein die knallharten ökonomischen Tatsachen, die beim politischen Management zusätzlich zu Buche schlagen. Es ist die Ideologie. Für deutsche und andere europäische Politiker kommt eine Verständigung und ein Interessenausgleich mit Rußland einfach nicht in die Tüte. Soviel Flurbereinigung muß sein: Die Ukraine gehört »uns« und nicht Rußland, koste es, was immer es wolle; ebenso Georgien und andere exsowjetische Staaten. Die Ukraine und Rußland haben den Preis zu zahlen — was für die EU offenkundig in Ordnung geht —, aber — und über diesen Zusammenhang wollen die Führungsfunktionäre nicht reden — nicht alleine! Das bleibt den Politikern zwar nicht verborgen, doch ihren eigenen kostenträchtigen Aufwand halten sie einfach für drängend notwendig.
Auch die USA wollen sich nicht zu den Dilemmata der EU-Staaten äußern, für die sie ja nicht unwesentlich verantwortlich sind. Den Opportunismus der EU-Staaten ihnen gegenüber, der sich in dem genannten Abkommen zeigt, halten sie für völlig ausreichend, um sich nicht weiter in deren inneren Belange einzumischen. Allüberall sind schließlich die Politiker an der Macht, die die USA völlig zu Recht für ihre Parteigänger halten können. Es ist ein Stück Sicherheit, das die USA zugebilligt erhalten, während für ihre »Partner« nichts abfällt, da mögen die sich einbilden, was immer sie wollen.
Interessant wird es, wenn die arroganten Staatsfiguren imperialistischer Staaten sich miteinander auseinandersetzen (müssen). Neulich, im Anschluß an den Alaska-Gipfel, kamen in Washington DC die Wichtigsten zusammen, der Trump, der Macron, der Starmer, der Merz, die Meloni und die Von der Leyen, der niederländische NATO-Chef. Die europäischen Figuren wollten, Trump möge am gemeinsamen NATO-Projekt festhalten, die Ukraine einzugemeinden, ein Projekt, das ohne maßgebliche Unterstützung der USA nicht möglich ist. Trump hingegen wollte und will, daß die Europäer die Lasten schultern , welche die USA bislang im wesentlichen für sie getragen haben. In diesem schönen Dialog war selbstverständlich unterstellt, daß die Ukraine — wenn man sie denn schon Rußland überlassen muß — so zugerichtet ist, daß Rußland damit wenig glücklich sein kann, daß ein ökonomischer Nutzen, eine kapitalistische Verwertbarkeit von Land und Leuten in der Ukraine auf längere Sicht sich nicht einstellt. Außerdem unterstellt ist, daß der Rußland zugefügte Schaden gar nicht groß genug sein kann. Offiziell wird am gemeinsamen strategischen Plan festgehalten, die Ukraine vor Rußland zu retten, ihm also gar befreite Gebiete über kurz oder lang wieder zu entreißen.
Wie in kapitalistischen Staaten üblich stehen für das nun fällige, voranzutreibende Projekt die Kosten und ihre Verteilung im Mittelpunkt. Der Streit geht darum, wer die immensen Kosten für die Gewaltmittel übernimmt, ohne die ein imperialistisches Projekt solcher Größe nun einmal nicht durchzuführen ist. In einer Hinsicht freilich stehen diese Kosten nicht zur Debatte: Insofern nämlich, als diese Kosten der jeweiligen staatlichen Manövriermasse aufgebürdet werden. Also daß die nationalen Arbeiterklassen all das auszuhalten haben, was an — in zwischenimperialistischer Konkurrenz zementierten — kostenintensiven Ansprüchen beschlossen wurde, steht außer Frage!
Die deutsche Öffentlichkeit weiß alsogleich, was sie zu propagieren hat. Das muß an dieser Stelle nicht dargestellt werden, der Leser schlage einfach eine x-beliebige Zeitung auf: Die Fakten sind immer in die Staatsräson, in deren Ideologie eingebettet. In dieser Weise werden sie dem Leser verabreicht — man könnte auch sagen: angedreht. Der etablierte Journalismus geht nämlich davon aus und er kann das erfahrungsgemäß, daß der Leser sich auf der Höhe des nationalen Zeitgeistes befindet. Gerade deshalb können die Medien davon ausgehen, weil sie dieses Nationalbewußtsein schaffen und täglich schüren. Das ist die Essenz einer »freien Presse«!
11.11.2025
© Kommunikation & Kaffee Augsburg
www.koka-augsburg.net:
Feedback: info@koka-augsburg.com
heinrich mann
Heinrich Mann
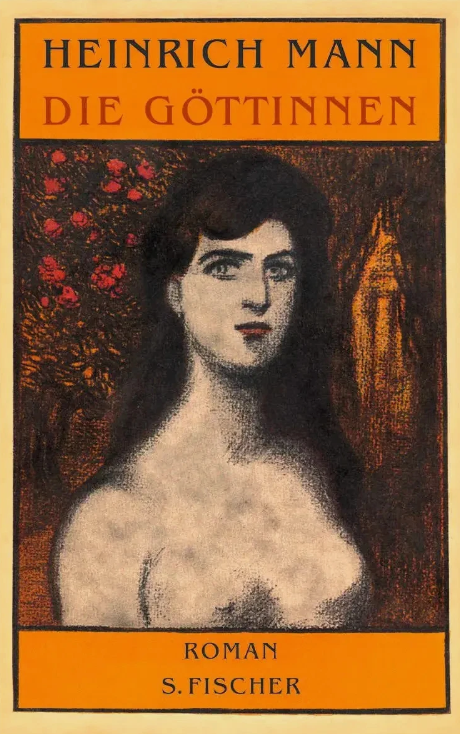 Heinrich Manns (1871-1950) »Die Göttinnen« — Diana, Minerva und Venus — erzählt von der Herzogin von Assy, die ihr Leben nacheinander der Freiheit, der Schönheit und der Liebe verschreibt. Die Sympathie für den Freiheitsdrang der von Italien und Österreichern unterdrückten Bevölkerung in Dalmatien läßt sie sich etwas kosten. Wer in Dalmatiens Hauptstadt Zadar (italienisch: Zara) reist, sollte sich Violante von Assy zuvor nicht entgehen lassen, um einen historischen Eindruck dieses Teils der Balkan-Halbinsel zu gewinnen. Und selbstverständlich noch einiges mehr. Es wäre verfehlt, die Romane bloß als romantisch hinzustellen, sie sind gleichwohl sozialkritisch, ja revolutionär.
Heinrich Manns (1871-1950) »Die Göttinnen« — Diana, Minerva und Venus — erzählt von der Herzogin von Assy, die ihr Leben nacheinander der Freiheit, der Schönheit und der Liebe verschreibt. Die Sympathie für den Freiheitsdrang der von Italien und Österreichern unterdrückten Bevölkerung in Dalmatien läßt sie sich etwas kosten. Wer in Dalmatiens Hauptstadt Zadar (italienisch: Zara) reist, sollte sich Violante von Assy zuvor nicht entgehen lassen, um einen historischen Eindruck dieses Teils der Balkan-Halbinsel zu gewinnen. Und selbstverständlich noch einiges mehr. Es wäre verfehlt, die Romane bloß als romantisch hinzustellen, sie sind gleichwohl sozialkritisch, ja revolutionär.
Die Schriftstellerin Birgit Vanderbeke schrieb für die Neuausgabe ein Nachwort: »Das Buch stand zu Hause im Giftschrank. Als ich es mir dort ungenehmigt ausgeborgt hatte, merkte ich schnell: Dort gehörte es auch hin. Es war üppig wie Buttercremetorte, herrlich unanständig, und man wurde im Kopf so beschwipst wie nach Amaretto, der schließlich auch verboten war. Später lernte ich, dass das der dekadente Charme des Fin de siècle ist. Noch später fing ich an, die Göttinnen besser zu kennen. Dann schmeckt es nicht mehr nur süß. Da kommen dann Heinrich Manns Witz und Schärfe durch, sein Vergnügen an der Vorstellung, 'mehrere Damen kreischen leise'. Heute ist mir, als seien sie alle drei, die junge Revoluzzerin, die spätere Kunstgläubige und die noch spätere Erotomanin, selbst von ihrem Autor ein wenig verkannt worden und als ahnte er unterschwellig das eigentliche, das wirklich beunruhigende Geheimnis seiner Violante, das indes den ganzen Roman ansteckt: 'Sie lachte laut auf, darauf fiel er lang auf den Teppich.'«
Die Formulierungskunst, mit dem Inhalt stets eng verknüpft, ist bei diesem Werk eigens zu würdigen: Brilliant!
Wer über die sonstigen Werke Heinrich Manns berichten will, sendet seinen Text an: info@koka-augsburg.com
Die Zentralisation des Kapitals und die Zertrümmerung des Proletariats
Eine realistisch erdachte Antizipation der kapitalistischen Entwicklung
Die Zentralisation des Kapitals und die Zertrümmerung des Proletariats
Claude Farrère¹ schrieb 1921 einen Zukunftsroman, der möglichst realistisch wirken sollte, dessen Geschehnisse heute allerdings schon wieder rund 30 Jahre zurückliegen. Indessen war dieser Roman selbst der heutigen Zeit in mancherlei Hinsicht um das ein oder andere voraus.
Die Zentralisation des Kapitals war weit fortgeschritten. In einer einzigen Fabrik, gelegen auf einer Insel im Mississippi-Delta, wurde das gesamte Brot für den amerikanischen Doppelkontinent hergestellt. Selbstredend war auch die Technik atemberaubend. Kleine Flugzeuge, landbar auf Flachdächern, eröffneten zumindest den Wohlhabenden bislang ungeahnte Mobilität. Nicht in dieses epochale Bild paßte da ein nach wie vor existentes Proletariat. Doch die Besitzer der Brotfabrik zeigten Herz und setzten es nicht einfach außer Brot². Das wäre nämlich möglich gewesen, da schon neueste Maschinerie eingetroffen war, die dies ermöglicht hätte. Die Schiffe mit dieser beladen wurden der Arbeiterschaft zuliebe und für sie außer Sichtweite weitab bei New Orleans verankert. Kurzum, die Arbeiter wußten davon nichts. Sie lebten in einer standardisierten Mustersiedlung mit mehrstöckigen Blocks, von der Firma für sie errichtet. In dieser gab es das für ihre Reproduktion nötige, Lebensmittelläden, Kneipen, Kinos, Kindergärten etc. Viele der Arbeiter fühlten sich durch die Eintönigkeit in dieser Wohngegend ebenso wie von der stumpfsinnigen Fabrikarbeit borniert und niedergedrückt. Manch einer versuchte sich durch Sabotage an den Backmaschinen Luft zu verschaffen, allenthalben erfolglos. Doch es gab auch einen, der den großen Aufstand plante. Dieser wurde ins Werk gesetzt, die Fabrik zu stürmen versucht. Mit brutaler Polizeigewalt wurde die Revolte niedergeschlagen. Schon anderntags langten die Schiffe mit den – den allergrößten Teil der Arbeiter ersetzenden – Maschinen an und so konnte die Produktion geradezu verzögerungslos fortgesetzt werden.
Aus Farrères Zeit heraus verständlich: Seinerzeit gab es noch eine Arbeiterbewegung. Die Arbeiterbewegung wurde über die Jahre vom demokratischen Staat, von seiner Bildungspolitik und den auf ihn verpflichteten Gewerkschaften sang- und klanglos abgewickelt. Ebensowenig konnte sich Farrère vorstellen, wieviele Arbeitskräfte als Selbstständige ausgelagert werden würden beziehungsweise zunehmend von vorneherein sind, Arbeitskräfte, die für das Kapital de facto zum Stücklohn – also jenseits einer geregelten Arbeitszeit – produzieren oder ihm anderweitig dienstbar sind.
Der Aktionismus der Arbeiterklasse, der – wie der Autor zeigt – an und für sich der Blindheit bedarf, wird im fatalen finalen Ansturm auf die Fabrik vorgeführt. Aktivisten handeln aufgrund einer rein moralischen Gesinnung. Wissen erübrigt sich für sie in aller Regel – nach der Devise: Man sieht doch, was Sache ist, und die ist zutiefst ungerecht. Diejenigen³ jedoch, die, wie sie glauben, mit Wissen unterwegs sind, behaupten gerne, daß Klassenbewußtsein und -kampf in Aktionen entwickelt werden können, diese also Voraussetzungen seien, die schließlich in einer grundsätzlichen Umwälzung der Verhältnisse münden sollten und müßten. Aber: So ein angedachter Übergang entbehrt der Logik, entbehrt jeder zwangsläufigen Notwendigkeit! Solch in Aktionismus resultierendes Klassenbewußtsein zeigt nur eines: Es ist ein beschränktes, die Kritik der Ökonomie ist nur eine sehr oberflächliche, obendrein fehlt überhaupt die Kritik der politischen Ökonomie, der Staatskritik. Schließlich ist es ja die Wirtschaft des Staates, der hat sie mit seiner puren Gewalt als private freigesetzt, ent- und beschränkt sie, kontrolliert sie also, er steht ihr ja vor.
Die kapitalistische Ökonomie hat sich für den Staat letzthin als die ihm zweckdienlichste und zuträglichste für die Schaffung nationalen Reichtums erwiesen. Die kapitalistische Wirtschaftsform verdankt sich.gewissermaßen der Ökonomisierung des Staates. Ebenso wie die Staatsform namens Demokratie sich für die Staat zu seiner Rechtfertigung und Legitimation sich als probateste erwiesen hat.⁴
Der Anspruch auf Profit wird aufgrund der im Kapital liegenden Notwendigkeit seiner permanenten Verwertung immer maßloser, entfernt sich immer weiter von seiner ökonomischen Grundlage. Auf diese Weise wird die Welt zugrunde gerichtet, ganz ohne Kriege, die.zu allem Überfluß keineswegs fehlen, ist der globale Kapitalismus doch in Form konkurrierender Nationen organisiert. Die versuchen ihre ökonomische Grundlage durch den Zugriff auf und gegen andere Staaten zu erweitern.
________________________
¹ Claude Farrère (1876-1957) in seinem Roman »Die Todgeweihten« [»Les condamnés à mort«], Drei Masken Verlag, 1922. Farrère war insbesondere an moderner Technik wie an der Psyche der Individuen interessiert.
² Sicher hat sich Farrère wohlwollend darin getäuscht, daß die Kapitalistenklasse gerade nach dem 1. Weltkrieg ein Mitgefühl für die Arbeiterklasse haben könnte oder aber einen blassen Schimmer, worauf ihr Profit beruht. Daß das Kapital auf die Gewalt des Staates zählen kann, war Farrère natürlich umso klarer.
³ Konsequenterweise führte das zu all den Beispielen in Sachen Ökonomie, die in der Sowjetunion und ihren Anhängerstaaten zu dem schnöden Nationalismus – und damit zur Westorientierung – geführt hat, an dem die Nachfolgestaaten bis heute zu ihrem eigenen Ruin leiden; in China zu einer Rekapitalisierung der Gesellschaft im Namen der Arbeiterklasse, des Sozialismus. Der Übergang von einer Teilrepublik der UdSSR zu einem heutigen faschistischen, pardon: demokratischen Staat wie der Ukraine ist nicht weit – deren Nationalismus hatte Chrustschow, zuvor Republikchef, mit der Angliederung der Ukraine gar noch honoriert.
⁴ Die Unklarheiten bezüglich des Klassenbewußtseins haben freilich schon ihren Anfang bei Lenin: »Der Staat ist eine Maschine zur Aufrechterhaltung der Herrschaft einer Klasse über eine andere.« [»Über den Staat«, Vorlesung an der Swerdlow-Universität, 11.07.1919] Er definiert den Staat als Mittel der Ausbeuterklasse. Er sieht den Staat nicht als Souverän an, der sich selber seine Zwecke setzt, eben auch und gerade in seiner Ökonomie. Lenin legt den Fehlschluß nahe, daß der Staat befreit werden müsse, aus den Händen der Bourgeoisie und in die des Proletariats überführt werden müsse. Der Staat ist nach Lenin also nicht ein Klassenstaat, ein Staat, der über den Klassen steht, sondern der Staat einer Klasse. Aus diesem Dogma heraus erschließen die Revisionisten, daß mit dem Klassenkampf der Staat von der Besetzung durch eine Klasse in die Besetzung der bisher unterdrückten überzugehen hat. Es handelt sich also um eine brutale Affirmation staatlicher Gewalt!
24.10.2025
© Kommunikation & Kaffee Augsburg
www.koka-augsburg.net
Feedback: info@koka-augsburg.com
The American Way of Life and Death
Der Fall des Charlie Kirk
The American Way of Life
Charlie Kirk war einer jener nationalistischen Wirrköpfe, welche eine Demokratie massenhaft hervorbringt. Er propagierte »The American Way of Life«, also den American Way of Life, dem er nun selber zum Opfer gefallen ist. Denn zu diesem weltberühmten American Way of Life gehört unzweifelhaft auch der American Way of Death.
Dies freilich birgt noch ein anderes Mosaiksteinchen. Nicht jeder der zahlreichen Knallköpfe bringt es zu solch immenser Massenwirksamkeit. Charlie hungegen wurde stark gesponsert ¬ von milliardenschweren Stiftungen und Personen. Jenen paßten sein moralisierendes Weltbild wunderbar ins Konzert: Der »Influencer« war ausersehen, sein Publikum auf der Linie des American Way of Life zu halten. So weit, so lief bislang alles bestens. Alle Äußerungen Charlies sprudelten wie am Schnürchen aus dem arg beschränktem Reservoir eines »gesunden Menschenverstandes«. Doch auf einmal passierte etwas Schlimmes: Charlie überkamen Bedenken bezüglich des israelischen Massenmords in Gaza, den er bislang als Apologet Israels so nicht wahrgenommen haben wollte. Und er ging in aller Öffentlichkeit auf Distanz zum dortigen Genozid. Das nun gefiel dem ein oder anderen Finanzier aus der Gruppe der Zionisten überhaupt nicht. Und wie es bei solchen Leuten, die wie Charlie dem American Way of Life & Death huldigen, üblich ist, machten sie gleichsam biblischen Prozeß mit dem Häretiker.
Der Einfluß jener Geldmagnaten ist so riesig, daß sie nicht ernsthaft mit einer Strafverfolgung rechnen müssen. Dem FBI sitzt bekanntlich ein gewisser Kash Patel vor, der die Ermittlungen im Falle von Jeffrey Epstein einfach nicht ernsthaft vorantreiben will. Der umfangreiche FBI-Bericht ist de facto schlicht unergiebig, ja irreführend, eröffnet Spekulationen, die allesamt wahrscheinlicher sind als die offiziell verbreitete Selbstmordthese. Wurde der Häftling ermordet oder gar entführt? Die Epstein-Files selber werden vom Justizministerium unter Verschluß gehalten, soweit jedenfalls, wie sie aufschlußreich sein können und das sind eine ganze Menge. Und jüngst verfügte der US-Senat mit der rebublikanischen Mehrheit von 51 Stimmen, daß keine weiteren Veröffentlichungen vorgenommen werden müßten. Ein Affront gegen die wenigstens im nachhinein etwas Gerechtigkeit verlangenden Opfer von Jeffrey Epstein, Ghislane Maxwell und all ihrer Geldkumpane. Die Opfer könnten allenfalls daraus lernen, wozu Democracy und der hochgelobte American Way of Life gut sind.
Für den US-Präsidenten Donald Trump ist indessen klar, daß der Fall Epstein von den tollen Erfolgen seiner Politik nur ablenken soll. Und er selbst lenkt von den Hintergründen im Fall Kirk ab, indem er ihn für seine politischen Zwecke verwendet, indem er gegen alle, die er für irgendwie »links« hält – was selbst die Demokratische Partei einschließt! –, Haßreden vom Stapel läßt. Die spontane Lobrede des zionistischen Mörderchefs auf Kirk übrigens ist nicht minder einer Ablenkung verdächtig!
Fast könnte man annehmen, daß die us-amerikanischen Zustände der seit dem Abgang der Sowjetunion total verblichenen ML-Ideologie wieder zum Leben zu verhelfen trachten, der zufolge der Staat sich in den Händen des Kapitals befindet und der deswegen aus dessen Okkupation befreit werden müsse. In der Tat wird der Schein erzeugt, es handle sich bei den USA nicht um einen Klassenstaat, sondern um den Staat einer Klasse. Kurioserweise werden die, die diesen Schein hervorrufen, von der Arbeiterklasse selber in Wahlen ermächtigt, die Herrschaft im besten Sinne auszuüben. Dafür allerdings ist ein Typ wie Charlie Kirk sehr hilfreich. Das geringste Problem wird sein, einen passenden Nachfolger zu finden, einen, der sich in all seiner Dummheit auch nicht verzettelt.
27.09.2025
© Kommunikation & Kaffee Augsburg
www.koka-augsburg.net
Feedback: info@koka-augsburg.com
Kapitalismus 2025: Eine ungeheure Datensammlung
Kapitalismus 2025: Eine ungeheure Datensammlung
Die Unterhaltungsindustrie auf der Überholspur
Das Profitinteresse des Kapitals war — historisch betrachtetet — von vorne herein nicht auf eine einzelne oder eine bestimmte Anzahl von Segmenten der Produktion beschränkt. Alle gesellschaftlichen Bedürfnisse wurden bedient und selbst das war nicht ausreichend. Immer mehr Gegenstände wurden erfunden, die einen nützlichen Gebrauchswert hatten. Oft und immer öfter rief erst die produzierte und auf dem Markt feilgebotene Ware die Nachfrage danach hervor. Die Fantasie der Menschen war schnell zu erregen, zu begeistern. So rasch, daß auch viel Zeug verkauft werden konnte, mit dem zwar ein gutes Geschäft zu machen war, dessen Qualität und/oder Halbwertszeit jedoch schwer zu wünschen übrig ließ, deren »Neben«wirkungen nicht unbeträchtlich waren. So ist das alles natürlich bis heute geblieben.
Immer schon war eine Wertschöpfung für den rein intellektuellen Raum vorhanden. Waren die Waren diesem Feld ursprünglich auf Zeitungen und Bücher ausgerichtet, kamen im Laufe des 20. Jahrhundert eine technikbasierte Ausweitung gigantischen Ausmaßes hinzu: Grammofon, Film, Radio, Fernsehen, CD/DVD, Computer, internetfähige mobile Geräte…
All dies benötigt jenseits von Hard- und Software Inhalte.¹
Diese Inhalte beschäftigen den menschlichen Geist und haben mit der täglichen Arbeit für Geld herzlich wenig zu tun. Diese Inhalte besetzen die sogenannte Freizeit. Das ist die Zeit, die das Individuum jenseits seiner täglichen Arbeitszeit zur Reproduktion seiner Kräfte nötig hat. Doch nur ein Teil dieser freien Zeit widmet das Individuum notwendigerweise dem Schlaf. Seit Erfindung des elektrischen Lichts ging diese Ruhezeit zurück — derzeit haben ca. 40% in der BRD nicht ausreichend Schlaf (dabei ist die Definition von »ausreichend« ohnehin schon auf ein Minimum hin definiert!) —, Schlafstörungen hingegen nehmen zu. Nicht deswegen, weil das Individuum ausreichend Schlaf nicht mehr in diesem Ausmaß nötig hat, vielmehr einfach deshalb, weil das Hirn über die tägliche Arbeit hinaus immer mehr beladen, ja belastet wird. Unterhaltung verspricht dem Individuum nämlich eine Kompensation für seine Defizite im Arbeitsleben und überhaupt für all die, die er in der kapitalistischen Gesellschaft erleidet.
Das Kapital hat im Verlauf seiner Entwicklung immer mehr im Unterhaltungssektor investiert. Soviel, daß dieser Sektor, die technischen Voraussetzungen dazugezählt, eine schier unglaubliche Zugkraft entwickelt hat. Im Jahre 2024 setzte die Unterhaltungsindustrie in der BRD 111,6 Mrd. € um, Tendenz steigend — zum Vergleich: Der Umsatz der Lebensmittelhersteller belief sich auf 232,8 Mrd. €, Tendenz fallend. Und selbst im globalen Süden hat allem dort herrschendem Hunger zum Trotz das Smartfon seinen Siegeszug angetreten (und zuvor schon das Fernsehen).
Das Individuum ist gerade über diese Schiene selber zum Produkt des Kapitalinvestments geworden. Dies wird perfektioniert durch eine ungeheure Datensammlung² der Bedürfnisse, die bei Kauf oder auch nur online beim Betrachten einer Ware erhoben werden. Diese Daten werden unmittelbar in die Produktion, nicht zuletzt in virtuelle Produktion, überführt, und deswegen allein schon sind die Daten werthaltig. Die Waren fluten die Märkte massenweise, sogar jenseits des gesamtgesellschaftlichen Bedarfs. Die Daten sind unentbehrlich nicht nur für Erfindung und Herstellung der Waren, sondern erst recht für deren Versilberung, für die letzte Transaktion, der Verwandlung von Ware in Geld.³
Die Unterhaltungsbranche hat das Individuum sicher im Griff: Gerade weil sie seine Bedürfnisse sozusagen rund um Uhr und Raum dominiert. Im Gegensatz zu Nahrungsmitteln etwa, deren Genuß seine natürliche Schranke hat, unwesentlich mehr gegessen und — die Alkoholabhängigen mal beiseite gelassen — getrunken werden kann und damit der Umsatz beschränkt ist, ist der der Sfäre der Unterhaltung schier grenzenlos. Sicher, man kann sich immer nur einem Medium gleichzeitig widmen, jeder leistet sich jedoch schrankenlos viel Zeug zur Unterhaltung. Wie oben bereits gesagt, verlangt das die Hoffnung auf Kompensation, das Bedürfnis nach Kompensation aller Unannehmlichkeiten, die das Individuum so erleidet. Und die Unannehmlichkeiten sind erfahrungsgemäß sonder Zahl.
Doch wenn es bloß das wäre! Mit den Medien werden ihm ja die Inhalte vermittelt, mit denen er weiterhin gesellschaftlich brauchbar gehalten bzw. gemacht wird. Ihm werden all die Klischees, Stereotypen, Gewußt-Wie-Rezepte bis hin zu politischen Freund- und Feindbildern — also die moralischen Orientierungspunkte — nahegebracht. So nahe, daß jeder automatisch aufs Abstellgleis geschoben wird, wenn er solchen Angeboten inhaltlich widerspricht, sich ihnen verweigert.
Die gesamten Entscheidungen von Politik und Wirtschaft werden dem Leser, Hörer, Zuschauer auf ein Unterhaltungsangebot so zugeschnitten, daß der alles eben so wahrnimmt, wie es dargestellt ist: Oberflächlich, leicht konsumierbar. Tatsachen sollen ebensowenig wie Maßnahmen nicht nach ihrem Grund befragt werden, Fragen überhaupt sind schon durch die Darstellung ausgeschlossen, es zählen Fakten — auch wenn nur allzu oft etwas nur als Faktum dargestellt wird, also erlogen ist. Daraus folgt jedenfalls: Kein Widerspruch erlaubt! Spekulationen, Wunschdenken obendrein sowieso uferlos.
Überhaupt ist die durchgesetzte Maxime in den führenden kapitalistischen Staaten: Alle Welt will belogen sein. Ohne Frage, gilt es doch stets, den Gegenüber über den Tisch zu ziehen, in der Wirtschaft wie in der Politik. Natürlich muß man diese Verlogenheit adaptieren, wenn man Karriere machen will. So erklärt es sich, daß die größten Halunken die besten Chancen haben und konsequenterweise auch ganz oben stehen: Sie pflegen die hohe Kunst der Verstellung. Den Oberhäuptern der Gesellschaft ist sie in Fleisch und Blut übergegangen.
Das macht es im übrigen gerade den Staaten schwer, die diese Maxime nicht kapiert haben oder nicht kapieren wollen. Das ist oftmals ein desaströser Lernprozeß, wie beispielsweise an Rußland zu sehen ist.
Die Verlogenheit, die gerade in der unhinterfragbaren, geradezu kindergerechten Vereinfachung eines Sachverhalts steckt, macht Politik so überaus kompatibel mit dem Märchenland der Unterhaltungsindustrie.
_____________________________
¹ Was die konkreten Inhalte sind, wie umfassend sie in den Alltag eingreifen, das kann sich leicht jeder selber ausmalen, ja an sich selber sehen. Eine Aufzählung wäre ohnehin nie vollständig.
² Es ist gerade so, als würde auf Marx' Einstieg in seine Kapitalanalyse noch eins draufgesetzt: »Der Reichtum der Gesellschaften, in denen die kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine 'ungeheure Warensammlung', die einzelne Ware als seine Elementarform.« (Karl Marx, Das Kapital, Band 1, S. 49)
³ Zu Umschlaggeschwindigkeit und Umschlagzahl des Kapitals und dessen Bedeutung im Fortschreiten der Entwicklung siehe Marx, Das Kapital, Band 2
01.09.2025
© Kommunikation & Kaffee Augsburg
www.koka-augsburg.net
Feedback: info@koka-augsburg.com
Politische Psychologie: Das Amerikanertum
Das Amerikanertum
Nationaler Erfolg schlägt sich im Bewußtsein politisierter Staatsbürger nieder, Mißerfolg nicht minder.
Es gibt zweifellos so etwas wie »Völkerpsychologie«. Allerdings nicht in dem herkömmlichen Sinn wie sie einstige und heutige Politiker in Deutschland und die mit ihm verbündeten Staaten geprägt haben: In ihrer Herrenmensch-Arroganz haben diese Figuren die Unterschiede der Menschen in den verschiedenen Ländern auf die Natur zurückgeführt und tun dies weiterhin. Diesen Rassismus können sie in ihrem politischen Denken und Handeln nicht verleugnen. Um Beispiele anzuführen: Warum durfte und darf die Türkei nicht der EU beitreten? Oder warum darf das »gemeinsame Haus Europa« nicht mit Rußland und Weißrußland gebaut werden, aber mit den Bandera-Nazis der Ukraine? Warum ist ein Damm gegen Flüchtlinge aus Afrika gebildet worden? Warum distanzieren sich Von der Leyen, Merz, Klingbeil und Co. nicht von Israels Genozids? Warum weifert sich Deutschland hartnäckig, im Krieg überfallenen Staaten wie Griechenland für Überfall und Gräueltaten zu entschädigen? Warum rehabilitiert Deutschland Offiziere der Nazi-Wehrmacht und stellt sie als Vorbild hin¹? Usw. usf. Niemand kann behaupten, daß all das politisch und ökonomisch wirklich zweckmäßig ist für die Staatsräson einer kapitalistischen Gesellschaft. Klar, es wird dennoch — mit verräterischen Vehemenz! — glauben gemacht. Doch keiner der vielzitierten »Experten« prüft diese Behauptungen und wagt, Einwände zu erheben; nicht einmal die Leute der Wirtschaft. Es könnte immer aufs neue überraschend sein — so man nicht um die Dringlichkeit kurzfristigen Profits wüßte —, schlägt man das Zentralorgan der Investoren, das Handelsblatt, auf, wie dort speziell der deutschen Außenpolitik aus dem Hirn gefressen wird: Dabei muß man kein tieferes Verständnis der Wirtschaft haben, um zu sehen, wie kontraproduktiv Wirtschafts- und Außenpolitik nicht nur aber gerade die der derzeitigen Regierung ist.
Aus Marxscher Sicht muß man sie gar als noch destruktiver einschätzen: Schließlich sind Investitionen ins Militär totes Kapital, Kapital, das dem Wirtschaftskreislauf entzogen wird: Waffen, die nicht eingesetzt werden, rosten vor sich hin, entwerten sich ohne irgendwem irgendetwas gebracht zu haben; werden sie eingesetzt, zerstören sie die Ökonomie erst recht.
Also was kann unter Völkerpsychologie im Gegensatz zu dieser zutiefst rassistischen Auffassung verstanden werden. Der Grieche Nikos Dhimu hat ein aufschlußreiches (auch auf deutsch erschienenes) Büchlein geschrieben: »Über das Unglück, ein Grieche zu sein«.² Dhimu ist ein politisierter Bürger, Anhänger seiner Nation. Als solcher hat er ein Riesenproblem: Griechenland stellt in der heutigen Welt einen abgehängten, schwachen Staat dar. Kein Vergleich zur Macht der griechischen Stadtstaaten in der Antike, in der die griechische Ökonomie mit ihrem weit verzweigtem Handel und die geistigen, wissenschaftlichen Errungenschaften so zentral waren, daß sich gar die griechische Sprache zur Weltsprache entwickelt hatte. Was Dhimu also so anschaulich vor Augen führt, ist, daß ein politisierter Bürger sein persönliches Image auf die Zugehörigkeit zu einer Nation zurückführt, genauer: zu deren Rang unter den Staaten: Wie selbstverständlich mißt er die Nation am Anspruch, Weltmacht zu sein. Immerhin vermeidet die NATO-, EU- und €-Mitgliedschaft dann seinen intellektuellen Selbstmord…
Kein Wunder, daß die Weltmacht USA in Sachen Nationalismus die Nr. 1 sind. Dieser so qua Erfolg gut begründete Nationalismus macht gleichwohl nicht Halt an den Grenzen einer Nation:
»… Je nachdem die politischen Formen eines fremden Landes denen der Vereinigten Staaten entsprechen, wird dieses Land, bei Gleichstand auf andern Gebieten, als dem Amerikanertum nahekommend erachtet. Doch wenn von diesem politischen Moment die Rede ist, wird gewöhnlich ein Synonym für den Begriff Amerikanertum gebraucht, und dieses lautet: Demokratie. …
Der Glaube an das Hinstreben der ganzen Welt zum Amerikanertum ist ihnen [den US-Amerikanern] so in Fleisch und Blut übergegangen, daß es nur sehr schwer aufgegeben werden wird; und wenn die Umstände sie zum Aufgeben zwingen, so besteht die Gefahr, daß sie die ganze internationale Zusammenarbeit aufgeben. Menschen, die so verdreht sind, daß sie Ausländer bleiben wollen, verdienen eben keine Hilfe. …«³
Aufzugeben kommt für die politische Führung natürlich nicht einfach dann infrage, wenn sie (zeitweise) mit ihren nationalen Ansprüchen nicht durch- oder vorankommt. Sie setzt alles daran, diesen ihr unerträglichen Zustand zu beenden. Sofern Wirtschaftskriege dazu nicht ausreichend sind, kommt der Einsatz des Militärs in Betracht.
Das nationale Programm, die Staatsräson ist unberührt, ungeachtet welche Personen und welche Partei die nationalen Spitzenämter bekleiden. Die Charaktermasken der Politik konkurrieren darüber gegeneinander: Wer ist der konsequenteste Anwalt der Nation.
Das ist Demokratie. Das ist us-amerikanisches Vorbild. Politisierte Bürger in aller Welt haben daran einen Narren gefressen. Und das ganz jenseits des Rangs ihres Staates im Konzert der Nationen.
__________________
¹ Im August 2024 unter Regie des Bundesverteidigungsministerium, vom SPD-Militaristen Pistorius geführt. Halbherzig wurde das dann doch wieder zurückgenommen, nachdem die taz getitelt hatte: »Mehr Wehrmacht wagen!« Aber allein wieviel Leute dafür bezahlt wurden, von der Politik beauftragt, solchen Scheiß auszuarbeiten und als ernsthaft und wichtig zu präsentieren, wirft ein schlagendes Licht darauf, was der demokratische deutsche Staat unter »Vergangenheitsbewältigung« versteht. Ganz abgesehen davon, daß der Nazi Stauffenberg, der sich als besserer Hitler verstand, nach wie vor in hohen Staatsehren steht..
² Νίκος Δήμου, Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας
³ Geoffrey Gorer, Die Amerikaner – Eine völkerpsycholgische Studie, 1949, dt. 1956, S. 163
30.08.2025
© Kommunikation & Kaffee Augsburg
www.koka-augsburg.net
Feedback: info@koka-augsburg.com
Die Leiden der linken Opposition
Der Haken, an dem linke Oppositionelle leiden
Sie leiden gerade insofern schwer, als sie in Wahlen ein Mittel sehen, um ihren menschenfreundlichen Anliegen zum Erfolg zu verhelfen.
»Die Leute, die Kerzen auf dem Altar des Ideals anzünden, haben immer eine Kerzenfabrik hinter sich.« (Dino Segre alias Pitigrilli in »Vegetarier der Liebe«) Das Perverse ist, daß sozial gesinnte, also links orientierte Leute weder eine Kerzenfabrik noch sonst eine Fabrik hinter sich haben, wenn sie Idealen huldigen. Sie wollen mit ihrem Idealismus ganz grundsätzlich gegen den Materialismus schlechthin ankämpfen, den sie für des Teufels halten. Ja, damit nehmen sie Abstand auch von ihrem eigenen Marterialismus: En vogue kam diese Haltung mit der Hippiebewegung in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Jene an sich sympathischen Typen damals empfahlen ein einfaches Leben, eine Flucht aus der kapitalistischen Konsumwelt. Doch diese hat die Bewegung alsbald wieder aufgesogen, allzu verlockend waren die Angebote der Warenwelt. Bunte, oft überaus praktische Gebrauchswerte hatten die ideellen »Werte«, mit denen man ja nichts anfangen konnte und kann, in den Schatten gestellt. Und nicht allein das. Die Idealismen wurden denen überlassen, die als Kapitäne der Wirtschaft, als Führer der Politik und als amtliche Schullehrer der Staatsräson sie zur Beschönigung ihrer gewaltbasierten Taten benutzen wollten und benutzt haben und weiterhin mit diesen Idealen propagandisch hausieren gehen.
Nichtsdestotrotz erheben die mittellosen, unbedarften Idealisten immer erneut ihr Haupt, messen Herrschaft und Wirtschaft an ihren — man kann getrost sagen — Utopien einer heilen Welt, einer antimaterialistischen Welt — ganz ohne irre zu werden. Sicher, der insbesondere unter der Jugend zirkulierende Idealismus legt sich in aller Regel im Laufe der Alterung seiner Protagonisten. Das kann man sehr deutlich sehen, an denen, die bei Wahlen »links« wählen. Also hierzulande an Parteien wie »Die Linke«, die Piratenpartei, »Die Partei« von Martin Sonneborn oder MeRA25 von Janis Warufakis [Γιάνης Βαρουφάκης].¹ Sehr gut bemerken sie mitunter, daß alle anderen Parteien nichts mit einem antimaterialistischen Idealismus am Hut haben, hingegen den Idealismus für ihren kapitalistischen Staat als dessen Rechtfertigung und zu dessen Verklärung benutzen.
Die Haltung all der idealistisch infizierten Opposition ist selbstredend keine der Arbeiterklasse. Diese Klasse (aus-)verkauft vermittels ihrer gewerkschaftlichen Organisationen ihre materiellen Interessen an ihre Gegner. Dabei ist unterstellt, daß sie mit diesen in einem Boot sitzt und Gegensätze deshalb zu unterbleiben hätten. Das Dementi eines fundamentalen Gegensatzes materieller Interessen also!
Manchem derer, die idealistisch unterwegs sind, fällt diese Trennung von der Arbeiterklasse störend ins Auge: Denn eigentlich, so meint ein solcher, gehörte gerade auch diese Klasse, die ja offenkundig wirklich nicht viel zu lachen hat, doch auch zur Opposition und es wäre erfolgversprechender, man zöge gemeinsam an einem Strick. Dieses Wunschdenken ist vor allem in der Partei »Die Linke« beheimatet. Dort macht man sich allerdings keinen Gedanken darüber, warum das nur ein Wunschdenken ist und bleiben muß. Denn weder dem eigenen Idealismus von einer Gesellschaftsordnung noch der sozialverträglichen nationalen Gesinnung der Arbeiterklasse möchte man zu nahe, auf die Füße treten. Und so gehen politische Opposition und die materielle Durchsetzung von Arbeiterinteressen gegen das Establishment eben nicht zusammen, zumal letztere eben gar nicht als wirklicher Gegensatz genommen werden.²
Natur- und Klimaschützer bringen ein materielles Interesse vor, da es sich um menschliche Lebensgrundlagen handelt, die tagaus tagein von einer kapitalistischen Wirtschaft zerstört werden. Freilich nur allzuoft wollen diese Schützer damit keine Gegnerschaft zu den gesellschaftlich obwaltenden Interessen eröffnen. Ganz im Gegenteil, sie meinen, daß ihre und jene Interessen im Grunde gar nicht auseinanderfallen dürften und schon gleich nicht sollten. Insofern machen sie einen Übergang vom materiellen Interesse hinweg zu einem Idealismus. Denn in der Tat liegt Natur- und Klimaschutz nur bedingt und sehr sehr untergeordnet im Interesse eines kapitalistischen Staates. Solch Schutz ist ja logischerweise ein nachgeordneter: Wie kommt man denn darauf, etwas schützen zu wollen, wenn es zuvor nicht verwundet worden ist?
Kein Wunder, daß sich also auch Klima- und Naturschützer im Kreise einer linken Idealistenpartei am ehesten wohlfühlen.
Noch etwas muß gesagt werden: Eine gewisse Naivität lassen Linksidealisten gegenüber anderen Staaten erkennen. Wenn irgendwo in der Welt oppositionelle Demonstranten unterwegs sind, dann wollen sie nicht herausfinden, welches Interesse jene überhaupt vertreten, was sie auf die Straßen treibt. Oft genug sind die Ansprüche doch nichts anderes als die, die westliche Einmischung in ihre Länder gutheißen und fordern, ja bis hin zu einem — in völliger Ignoranz gegenüber den Interessen der imperialistischen Staaten — geforderten Umsturz. Mit solchen Demonstranten sich hierzulande solidarisch zu erklären, ist die Perversion jeglichen materiellen Interesses, paßt also ausgezeichnet zu einem radikalisierten Idealismus.
Mit einem auf die Spitze getriebenen Idealismus glauben seine Protagonisten doch gleichwohl bei der Herrschaft früher oder später Gehör finden zu müssen. Und in diesem Vorhaben entdecken sie nicht ihrer Täuschung, lassen sich nicht so leicht ent-täuschen. Im Gegenteil, dieser Irrtum verführt sie mitunter zu immer noch radikalerem Protest. Sicher, nur wenige werden Anarchospontis, doch auch diese Sackgasse eröffnet sich allen Idealisten.
_______
¹ Auch DIE GRÜNEN starteten als Idealistenpartei. Der Abschied vom Idealismus erforderte die Ermordung ihrer damaligen Parteichefin Petra Kelly.
² Die Gewerkschaften ködern ihr Arbeiterklientel regelmäßig mit einem Ideal von Gerechtigkeit. Sie verstehen sich auf die gleichen Heucheleien wie die Politik. Bei denen, die vorgeben, sich um die materiellen Interessen ihrer Klasse zu kümmern, ist das besonders gemein.
27.08.2025
© Kommunikation & Kaffee Augsburg
www.koka-augsburg.net
Feedback: info@koka-augsburg.com
